Schöne Feiertage und einen guten Start ins neue Jahr
Die Mitarbeiter*innen des Instituts für Didaktik der Geschichte wünschen allen Studierenden und Kooperationspartner*innen frohe Feiertage und alles Gute für das Jahr 2025!

Institutskolloquium
Im Rahmen des Institutskolloquiums spricht am 17.12.2024 Ricarda Singh zu dem Thema: „‚Denkmäler sollten sich […] etwas mehr anstrengen!‘ − Denkmalkontroversen in Hamburg und Wien“.
Di 18-20 Uhr (s.t.), Fürstenberghaus, Domplatz 20-22, F 073



Institutskolloquium
Im Rahmen des Institutskolloquiums spricht am 03.12.2024 Martin Berghane zu dem Thema: „Von der Theorie zur Empirie und zurück. Zu den ersten Schritten des Promotionsprojekts ‚Die Genese des Subjekts im Museum. Von den Wechselwirkungen zwischen Geschichtskultur und historischer Identität‘“.
Di 18-20 Uhr (s.t.), Fürstenberghaus, Domplatz 20-22, F 073
Podiumsdiskussion am Gymnasium Paulinum
Im Rahmen einer Podiumsdiskussion am Gymnasium Paulinum diskutierte Dr. Marin Schlutow am 20.11.2024 gemeinsam mit Schüler*innen der 10. Jahrgangsstufe, Dr. Christoph Spieker und Stefan Querl vom Geschichtsort Villa ten Hompel über den geschichtskulturellen Umgang mit dem Holocaust im deutsch-niederländischen Vergleich. Die Veranstaltung bildete den Abschluss einer Studienfahrt zur Gedenkstätte Westerbork in den Niederlanden.



Institutskolloquium
Im Rahmen des Institutskolloquiums spricht am 05.11.2024 Felix Ostermann zu dem Thema: „Überzeugungen von Lehramtsstudierenden im Fach Geschichte zum historischen Lehren und Lernen an Gedenkstätten - ein Werkstattbericht“.
Di 18-20 Uhr (s.t.), Fürstenberghaus, Domplatz 20-22, F 073


PD Dr. Wilhelm Ribhegge (*1940, †2024)
Das Institut für Didaktik der Geschichte trauert um das ehemalige Institutsmitglied PD Dr. Wilhelm Ribhegge. Herr Ribhegge war seit dem Jahr 1967 bis zu seiner Pensionierung als Wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Pädagogischen Hochschule Münster bzw. der Universität Münster tätig. Er verstarb am 06.10.2024.





Wintersemester 2024/25
Das Institut für Didaktik der Geschichte wünscht allen Studierenden einen guten Start in das Wintersemester 2024/2025. Einen Überblick über die Sprechzeiten in diesem Semester finden Sie hier sowie auf den Seiten der Mitarbeitenden.

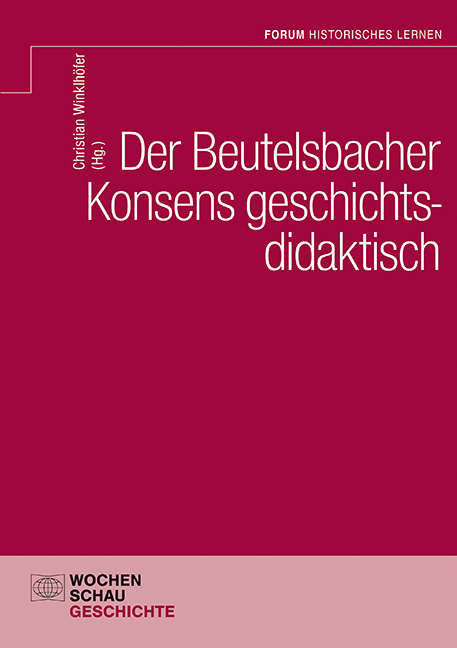
Auftaktworkshop zum Geschichtswettbewerb des Bundespräsidenten im Stadtarchiv Münster
Am Montag den 02.09.2024 findet im Stadtarchiv Münster in Kooperation mit dem Institut für Didaktik der Geschichte der regionale Auftaktworkshop zum Geschichtswettbewerb des Bundespräsidenten statt. Das Programm finden Sie hier.

Disputatio Johanna Glandorf am 16.07.2024
Das Institut für Didaktik der Geschichte gratuliert Johanna Glandorf herzlich zur abgeschlossenen Promotion mit dem Titel „Professionell-begabungsförderndes Handeln von Tutor*innen im Geschichtswettbewerb des Bundespräsidenten. Eine empirische Studie zu Individueller Förderung und Forschend-historischem Lernen“. Die Dissertation wurde von Frau Prof. Dr. Saskia Handro (Erstgutachterin) und Herrn Prof. Dr. Holger Thünemann (Zweitgutachter) betreut.
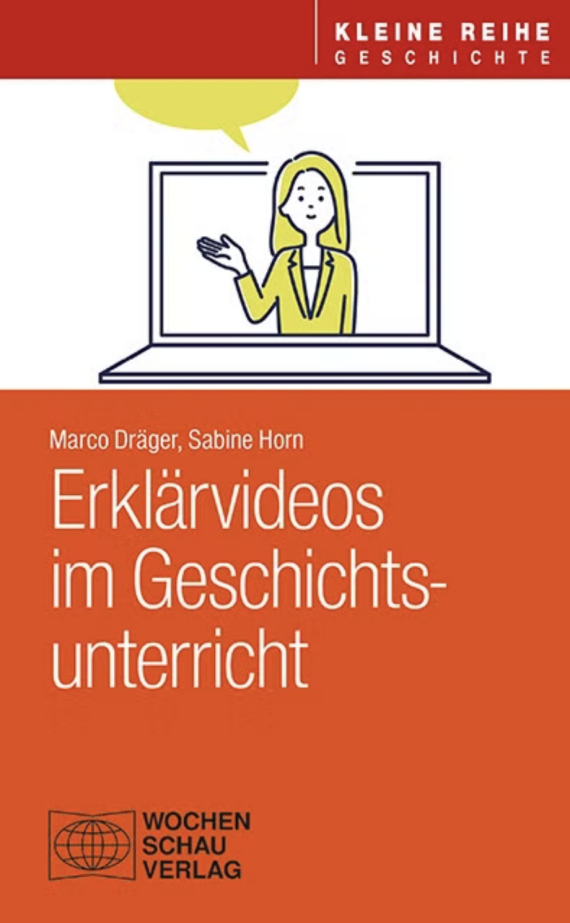

Wahlergebnisse Institutsvorstandswahlen
Bei den Wahlen zum Institutsvorstand wurden als akademische Mitarbeiter:innen Dr. Viola Schrader als ordentliches Mitglied und Dr. Manuel Köster als stellvertretendes Mitglied gewählt. Frau Maroula Mauczik wurde als Mitarbeiter:in in Technik und Verwaltung in den Institutsvorstand gewählt. Der Wahlausschuss hat entschieden, dass keine ordnungsgemäße Wahl für die Gruppe der Studierenden in den Vorständen der Lehreinheiten durchgeführt werden konnte.

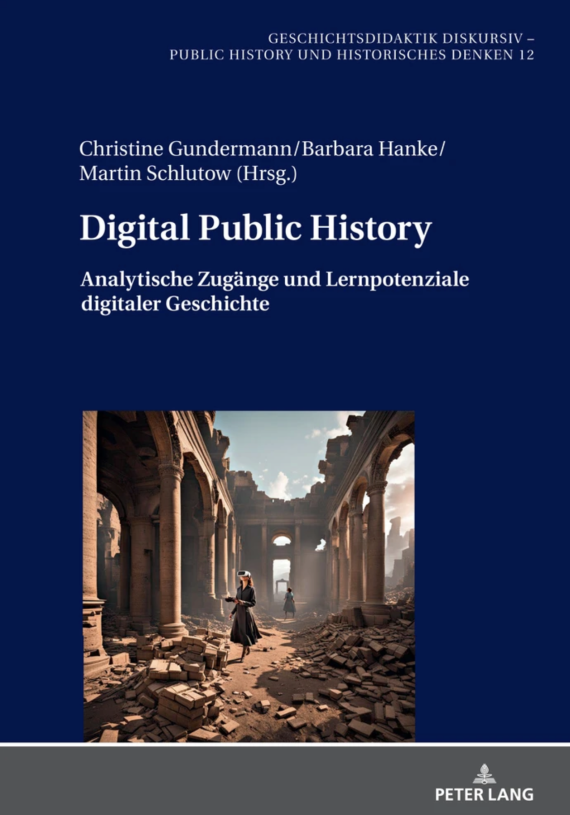




Sommersemester 2024
Das Institut für Didaktik der Geschichte wünscht allen Studierenden einen guten Start in das Sommersemester 2024!
Aktuelle Sprechzeiten finden Sie hier sowie auf den Seiten der Mitarbeitenden.
Neue Lehrkraft für besondere Aufgaben
Das Institut für Didaktik der Geschichte begrüßt zum 01. April 2024 Martin Berghane herzlich als Lehrkraft für besondere Aufgaben.



Sprechzeiten in der vorlesungsfreien Zeit
Das Institut für Didaktik der Geschichte wünscht allen Studierenden eine produktive und erholsame vorlesungsfreie Zeit. Einen Überblick über die aktuellen Sprechzeiten finden Sie hier.
Öffnungszeiten der Bibliothek in der vorlesungsfreien Zeit
Bitte beachten Sie, dass in der vorlesungsfreien Zeit andere Öffnungszeiten für die Bibliothek gelten: Montag - Freitag (10 - 18 Uhr).




