
Forschungsfeld Evolution: vier Fragen, vier Perspektiven
Hat Charles Darwin den Begriff der Evolution erfunden?

‚Evolution‘, von lat. e-volvere, ‚Aus-rollen‘ (etwa einer Schriftrolle), steht seit dem Ende des 17. Jahrhunderts für biologische Entwicklung. 150 Jahre vor Darwin war damit die individuelle Entwicklung eines Organismus gemeint, die Ontogenese. Als Evolutionstheorie wird eine spezielle ontogenetische Hypothese bezeichnet: In der Eizelle oder im Spermium sei bereits der ganze Organismus vorgeformt, Entwicklung bestehe allein in seinem Wachstum.
Als Charles Darwin (1809 – 1882) in den Jahren 1858/59 seine Theorie der Entwicklung der biologischen Arten durch natürliche Selektion vorstellte, war der Evolutionsbegriff noch so stark embryologisch geprägt, dass er ihn vermied. Erst später, als auch andere Autoren ihn zunehmend phylogenetisch verwendeten, griff er ihn auf.
Vorstellungen von phylogenetischer Evolution gab es schon zuvor, insbesondere bei dem Botaniker und Zoologen Jean-Baptiste de Lamarck (1744 – 1829). Neu bei Darwin war die Angabe eines Evolutionsmechanismus. Dieser erklärt erstmals den Artenwandel. Heute sind neben dem Darwinschen Mechanismus von Variation, Selektion und Vererbung weitere Evolutionsmechanismen bekannt, wie Gendrift, also die zufällige Veränderung der Häufigkeit einer Genvariante innerhalb einer Population, oder Nischenkonstruktion: Die aktive Veränderung der Umwelt durch die Organismen, womit sich die Selektionsbedingungen auch für Folgegenerationen ändern.
Auch außerhalb der Biologie ist von Evolution die Rede, beispielsweise von der Evolution des Kosmos oder von der geologischen Evolution der Erdoberfläche. Hier steht der Begriff allgemeiner für langfristige Prozesse der Hervorbringung neuer Strukturen. Und die kulturelle Evolution – ist dies eine Evolution im spezifisch biologischen oder in einem allgemeineren Sinne? Oberflächliche Ähnlichkeiten mit biologischer Artbildung sollten nicht zu voreiligen Schlüssen verleiten. Die vielfältigen Mechanismen kulturellen Wandels müssen separat untersucht werden.
Welche Rolle spielt Evolution bei der Erforschung von Krankheiten?

Die evolutionäre Perspektive betrachtet Gesundheit und Krankheit vor dem individuellen genetischen Hintergrund im Kontext der jeweiligen Umgebung. Dabei spielen insbesondere evolutionäre Prozesse wie Mutation, Selektion und Drift eine große Rolle. So unterscheiden sich die Genome der unterschiedlichen Ethnizitäten deutlich – sowohl in ihren genetischen Variationen als auch in der Struktur des Genoms. Genome von Europäern sind beispielsweise aufgrund des sogenannten Flaschenhals-Effekts, einer drastischen Verringerung der genetischen Varianz, viel weniger variabel als die Genome von Afrikanern, die die ältesten Populationen des Menschen repräsentieren.
Die Spezies Mensch hat sich von Afrika ausgehend in verschiedenen Migrationswellen über die Erde ausgebreitet. Aufgrund der evolutionären Anpassungen an die jeweilige Umwelt unterscheiden sich die Genome von menschlichen Populationen in Afrika, Asien und Europa deutlich. Diese genetische Varianz beeinflusst die Krankheitsprädisposition und somit auch, wie eine Patientin oder ein Patient auf Medikamente anspricht. Dies kommt zum Tragen, wenn Medizinerinnen und Mediziner versuchen, das individuelle Krankheitsrisiko in der Interaktion mit dem jeweiligen Umfeld und unter Zuhilfenahme von klinischen Parametern, Biomarkern sowie genetischer Information besser vorherzusagen. Somit spielt die evolutionäre Medizin eine wichtige Rolle bei der Erforschung komplexer (Volks-)Krankheiten.
Bedeutet Evolution immer Höherentwicklung oder Fortschritt?

Manche Organismen treiben es damit sogar auf die Spitze: Parasiten haben oft einen extrem reduzierten Körper. So besteht zum Beispiel der Parasit Sacculina nur noch aus einem verzweigten Fadengeflecht im Körper seines Wirtes, einer Krabbe. Sacculina stammt von freilebenden Rankenfußkrebsen ab, zu denen die bekannten Seepocken gehören. Diese haben einen Körper mit allem, was dazugehört. Letztlich geht es um die Anpassung an die jeweilige Umwelt, und die kann mit erhöhter Komplexität einhergehen – oder eben mit Reduktion.
Schließlich gibt es noch eine interessante Beobachtung beim Vergleich der Erbsubstanz DNA. Die meisten Unterschiede zwischen Individuen haben vermutlich keinen Einfluss auf die Anpassung, sie sind schlichtweg neutral. Auch in diesem Fall können wir also kaum von einem Fortschritt sprechen. Fazit: Auch wenn der Prozess der Evolution in seiner Gesamtheit eine Entwicklung zu mehr Komplexität darstellt, gilt das nicht für jedes einzelne Beispiel.
Hat der Mensch die Sprache erfunden, oder ist sie ein Produkt der Evolution?
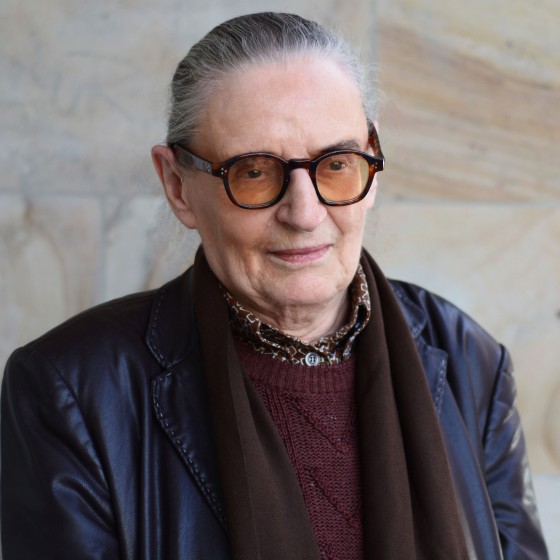
Unter dem Einfluss der Neurowissenschaften und im Kontext der Philosophie des Geistes, bestimmte Noam Chomsky, Begründer der modernen Sprachwissenschaft, die Sprache als „eine biologische Eigenschaft, eine Subkomponente (vor allem) des Gehirns, ein Organ des Geistes/Gehirns“. Die alte Frage, ob der Mensch die Sprache „erfunden“ habe oder ob sie durch einen „Evolutionssprung“ entstanden sei, ist damit beantwortbar geworden: Organe „wachsen“, wie das Gehirn an Volumen zunimmt. Der Neurologe und Linguist Eric Lenneberg hat sogar von einem „sprachspezifischen Reifungsplan“ gesprochen, der nicht nur phylogenetisch, sondern auch ontogenetisch in der entsprechenden Entwicklungsphase des Organismus aktiviert wird.
Die Lautentwicklung des Kleinkindes, der Aufbau des Phonemsystems, beginnt mit der Kontrastbildung der Lippen- und Zahnlaute (Labiale und Dentale), am Kontrast von nasal und nicht nasal, [m] und [b] oder [d] und [t]. Die Lautbildung der Urmenschen wird oft mit „Grunz- und Schnalzlauten“ beschrieben, die in der hinteren Mundhöhle beziehungsweise im Rachen gebildet werden. Wie und was der Neandertaler davon realisiert hat, bleibt weitgehend der Spekulation überlassen und wird kontrovers diskutiert. Aber auch seine Körpersprache, Gestik und Mimik begleiten die Lautproduktion und dienen der Informationsübermittlung wie dem Gefühlsausdruck. Sprache ist eben ein „Organ“, ein Naturprodukt in einem Wachstumsprozess.
Dieser Artikel stammt aus der Unizeitung wissen|leben Nr. 1, 31. Januar 2024.
