Themen der Liturgiewissenschaft
Auf dieser Seite stehen kurze Antworten auf aktuelle Ereignisse, Beobachtungen zu Festen und Daten des Jahreskreises und Notizen zu einzelnen Fragen der Liturgiewissenschaft.
Auf dieser Seite stehen kurze Antworten auf aktuelle Ereignisse, Beobachtungen zu Festen und Daten des Jahreskreises und Notizen zu einzelnen Fragen der Liturgiewissenschaft.
Am 8. Mai 2025 war es so weit: Die römisch-katholische Kirche hat einen neuen Papst. In nur knapp 26 Stunden nach Beginn des Konklaves am Vortag wurde der US-Amerikaner Kardinal Robert Francis Prevost zum 267. Nachfolger Petri gewählt. Er trägt nun den Namen Leo XIV. – ein letzter liturgiewissenschaftlicher Kommentar zum Ende und Beginn eines Pontifikats. Weiterlesen
Am 7. Mai 2025 um 10 Uhr versammelten sich die 133 wahlberechtigten Kardinäle im Petersdom zu einem feierlichen Gottesdienst, um den neuen Papst zu wählen. Das heutige Konklave ist eine hochstilisierte Liturgie, die– im Unterschied zur demokratischen Wahl eines Amtsträgers – als eine heilige Handlung verstanden werden soll. Mit dem feierlichen Ruf „Extra omnes“ („Alle hinaus“) nach dem Einzug in die Sixtinische Kapelle werden alle Anwesenden, die nicht stimmberechtigt sind, hinausgebeten. Ein bedeutender Akteur bleibt jedoch zurück. Weiterlesen
Am Freitagabend, dem 25. April 2025, wurde der Sarg des Papstes verschlossen – noch vor dem Requiem am Samstagvormittag um 10 Uhr (Missa exsequialis). Ein Kommentar zur feierlichen Verabschiedung des Papstes und dem Ende eines zwölfjährigen Pontifikats. Weiterlesen
Trotz der Überarbeitung des Ordo Exsequiarum Romani Pontificis (aus dem Jahr 2000) durch Papst Franziskus im Jahr 2024 hinterlässt die liturgische Inszenierung der Exequien – der feierlichen Bestattungsriten – für den Römischen Papst einen bleibenden Eindruck. Die Liturgie soll allen Menschen Hoffnung auf das ewige Leben schenken. Die Überführung des Leichnams in den Petersdom am 23. April 2025 stellte eine Etappe innerhalb dieser aufwendigen Zeremonie dar. Über Vatican News konnte die Öffentlichkeit die Prozession in Echtzeit verfolgen. Weiterlesen










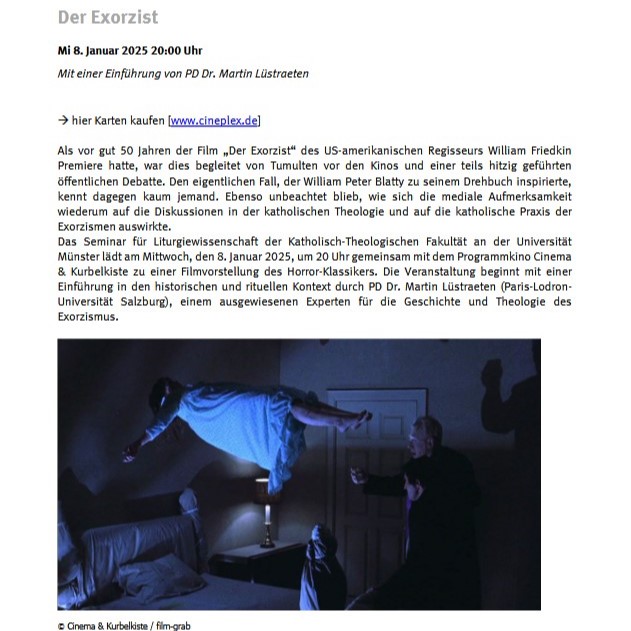
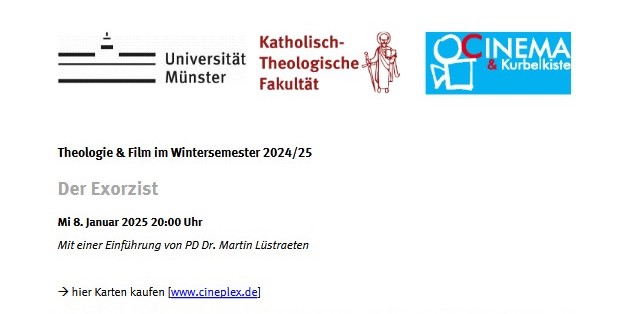





Theologiestudierende im Hauptstudium haben die Möglichkeit, ein Studienjahr an der Hebräischen Universität Jerusalem zu verbringen. Dort besteht nicht nur die Möglichkeit die Kenntnisse des Alt- und Neuhebräischen zu vertiefen, sondern auch in der Heiligen Stadt das Judentum und das Orientalische Christentum mit ihrer Theologie und Liturgie näher kennen zu lernen und im eigenen Theologiestudium somit einen Schwerpunkt zu definieren. Organisiert und finanziert wird dieses Projekt durch den Verein Verein „Studium in Israel“ und die EKD.