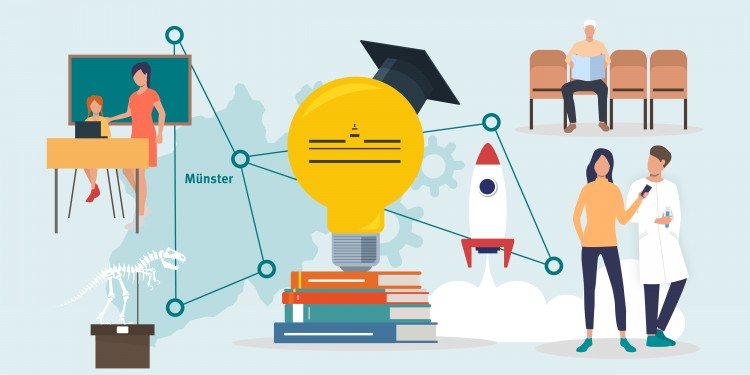
„Transfer ist nicht etwas für den Feierabend“
Seit einigen Jahren gewinnt der Wissenstransfer an deutschen Hochschulen immer mehr an Bedeutung und wird zunehmend als wissenschaftliche Leistung anerkannt. Die Forschungsvermittlung in die Gesellschaft findet auf ganz unterschiedlichen Wegen statt und ist als dialogischer Prozess zu verstehen. Kathrin Nolte sprach mit Dr. Annette Barkhaus, der stellvertretenden Leiterin der Abteilung Forschung des Wissenschaftsrats, über die Herausforderungen des Wissenstransfers für deutsche Hochschulen und Forschungseinrichtungen.
Der Wissenschaftsrat hat im Jahr 2016 das Positionspapier „Wissens- und Technologietransfer als Gegenstand institutioneller Strategien“ veröffentlicht. Was verstehen Sie unter dem Begriff Transfer?

In Ihrem Vorwort haben Sie bereits vor drei Jahren festgestellt, dass der Transfer von Wissen in Gesellschaft, Kultur, Wirtschaft und Politik immer stärker in den Fokus wissenschaftspolitischer Aufmerksamkeit gerückt ist. Welchen Stellenwert nimmt der Wissenstransfer in der deutschen Hochschullandschaft Ihrer Beobachtung nach mittlerweile ein?
Gesellschafts- und wissenschaftspolitisch ist dieser Stellenwert seit 2016 deutlich gestiegen und wird – so meine Prognose – in Zukunft aus zwei Gründen noch weiter steigen. Erstens besteht die Notwendigkeit, gesellschaftliche Herausforderungen anzugehen und Wissen als Grundlage für Innovationen zu generieren. Der zweite Grund, der sich im Jahr 2016 erst in Ansätzen abgezeichnet hat, ist die Diagnose einer fragiler werdenden Demokratie. In diesem Zusammenhang trägt die Wissenschaft die Verantwortung dafür, informierte Entscheidungen für die Bürger vorzubereiten und das Vertrauen in ihre Arbeit zu stärken. Das sagt sich leicht, ist heute in der Praxis – Stichwort ,Expertenskepsis‘ – aber eine Herausforderung.
Wie können Hochschul- und Forschungsinstitutionen diese Aufgabe meistern?
Hochschulen und Forschungseinrichtungen haben bereits große Anstrengungen unternommen, Transfer als eine Dimension ihrer wissenschaftlichen Arbeit ernst zu nehmen. Transfer ist ein integraler Bestandteil wissenschaftlichen Arbeitens und nicht allein etwas für den Feierabend. Derzeit vollzieht sich ein Wandel in der Wissenschaftslandschaft: Transferarbeiten werden zunehmend als wissenschaftliche Leistung anerkannt und können sich damit günstig auf die Reputation auswirken. Denn die Übersetzungsarbeit, die die Wissenschaftler erbringen, oder der Dialog mit unterschiedlichen gesellschaftlichen Akteuren benötigt Zeit und Ressourcen, die bereitgestellt werden müssen und dann nicht länger zum Beispiel für Forschungsarbeiten zur Verfügung stehen.
Vor welchen Herausforderungen stehen die wissenschaftlichen Einrichtungen im Umgang mit ihrer gesellschaftlichen Verantwortung?
Eine Herausforderung für Universitäten und Forschungsinstituten liegt darin, eine kohärente Transferstrategie für die gesamte Einrichtung zu erarbeiten – gerade im Fall einer Volluniversität wie die WWU. Eine solche Strategie kann einer Institution nicht von oben übergestülpt werden. Vielmehr sollten die jeweiligen Potenziale erkannt und konkrete Umsetzungsmaßnahmen entwickelt werden. Nach Auffassung des Wissenschaftsrats sollten Forschung, Transfer und Lehre dabei ineinandergreifen. Gerade in Zeiten der bereits angesprochenen fragiler werdenden Demokratie liegt eine weitere Herausforderung darin, sich auf Regeln guter Transferpraxis in den unterschiedlichen Handlungsfeldern wie Wissenschaftskommunikation, Beratung und Anwendung zu verständigen. Diese Regeln sind notwendig, um das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in die Wissenschaft zu stärken. Dabei spielen auch Fragen der Transparenz – zum Beispiel über die Finanzierung von Forschungsprojekten – eine wichtige Rolle. Bereits für Nachwuchswissenschaftler sollte es selbstverständlich werden, Transferleistungen zu erbringen und dafür – ebenfalls eine Herausforderung – wissenschaftliche Anerkennung erringen zu können. Auf diesen Feldern gibt es in Deutschland Nachholbedarf. In der US-amerikanischen und asiatischen Hochschullandschaft gehören Transferaktivitäten schon in das Portfolio und wirken sich reputations- und karriereförderlich aus.
Wie lauten Ihre Empfehlungen, um den wachsenden Erwartungen gerecht zu werden? Wie sollten die Institutionen und der einzelne Forscher die Transferaktivitäten verankern?
Unsere Empfehlung lautet: Macht euch strategisch auf den Weg und schafft Unterstützungsstrukturen für alle Wissenschaftler! Jede Universität, jede Forschungseinrichtung, aber auch jede Forscherin und jeder Forscher sollte auf der Grundlage des eigenen Potenzials den individuellen Weg finden. Nicht jedes einzelne Forschungsprojekt birgt schon gleich ein Transferpotenzial. Die Position des Wissenschaftsrats ist vielmehr, eine eigene institutionelle Strategie zu erarbeiten, die Verantwortung für Transfer auf der Leitungsebene zu verankern und Transferaktivitäten je nach Fach, Potenzial und Forschungseinheit differenziert zu fördern. Dazu braucht es Unterstützungsstrukturen und Ressourcen – zentral und dezentral. Diese zu schaffen und bereitzustellen, ist Aufgabe der Leitung.
Dieses Interview stammt aus der Universitätszeitung „wissen|leben“ Nr. 1, Februar / März 2020.
