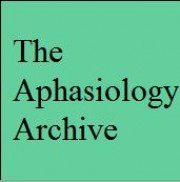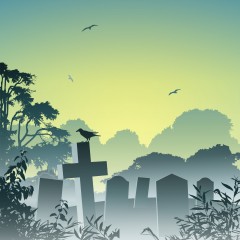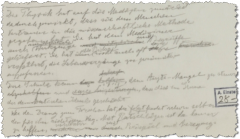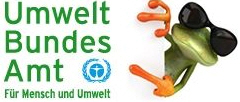Foto: Artikel aus der FAZ
Martina Lenzen-Schulte hat in der FAZ vom 28. August (Nr. 199, S. N1) unter dem Titel „Was die Leitlinien den Ärzten verschweigen – Millionen Herzkranker folgen dem Rat eines Betrügers“ (verfügbar im Hochschulnetz) auf verschiedene Fälle von Leitlinienirrtümern hingewiesen.
So sollen Tausende von Toten in Europa […] auf das Konto einer derzeit gültigen Leitlinie der Europäischen Gesellschaft für Kardiologie gehen. Grund: Eine zu günstige Bewertung von Betablockern aufgrund von wissenschaftlichem Fehlverhalten.
Viele weitere Beispiele finden Sie in einem verstörenden Bericht von Jeanne Lenzer im British Medical Journal mit dem Titel Why we can’t trust clinical guidelines. Dort wird anhand von wohlbekannten Betrugs- und neu aufgedeckten Verdachts-Fällen (auch in der renommierten Cochrane Library) aufgezeigt, dass auch Leitlinien nicht über jeden Verdacht erhaben sind.
Guidelines are usually issued by large panels of authors representing specialty and other professional organisations. While it might seem difficult to bias a guideline with so many experts participating under the sponsorship of large professional bodies, a worrying number of cases suggests that it may be common. A recent survey found that 71% of chairs of clinical policy committees and 90.5% of co-chairs had financial conflicts.
Ärzte geraten immer wieder in ein Handlungsdilemma: Wenn Sie die Leitlinie anwenden, kann es ihren Patienten schaden. Behandeln sie nicht leitliniengetreu, kann es ihrer Karriere schaden. Letzteres hat die ungute Konsequenz, dass Ärzte Leitlinien befolgen, obwohl sie nicht an deren Wissenschaftlichkeit glauben. Warum sollte man sowas tun? Many cited a fear of malpractice if they failed to follow „a standard of care“.
Eine Analyse von Gisela Schott et. al. im deutschen Ärzteblatt kommt unter dem Titel Besteht ein Einfluss pharmazeutischer Unternehmen auf Leitlinien? Zwei Beispiele aus Deutschland zu dem Ergebnis, dass „auch gegenüber deutschen Leitlinien eine gesunde Skepsis angebracht ist“. Bereits 2010 hatte Frau Schott nachgewiesen, dass pharmazeutische Unternehmen Studienprotokolle zu ihren Gunsten beeinflussen.
Beliebte Manipulationen sind:
- selektive Auswertung von Patientendaten
- nachträgliche Veränderungen des primären Endpunktes
- in Anbetracht der Ergebnisse unangemessen positive Formulierung der Zusammenfassung
- Autorschaft durch Ghostwriter
Die von Frau Schott aufgedeckten Abhängigkeiten bei der Erstellung der S3-Leitlinie der Deutschen Dermatologischen Gesellschaft (DDG) zur Therapie der Psoriasis vulgaris durch Efalizumab sind wirklich haarsträubend:
- Die Serono GmbH (der Efalizumab-Hersteller) förderte die DDG finanziell.
- Zahlreiche Leitlinienautoren erhielten finanzielle Zuwendungen der Serono GmbH oder führten Beratertätigkeiten für sie aus.
- Die Angaben zu den Interessenkonflikten der Autoren waren nicht in der Leitlinie, sondern nur auf der Webpage der Arbeitsgruppe zu finden.
Von den 15 stimmberechtigten Teilnehmern am Konsensusverfahren der S3-Leitlinie gaben zehn teilweise zahlreiche finanzielle Verbindungen mit bis zu elf verschiedenen pharmazeutischen Unternehmen an.
Die AWMF hat mittlerweile reagiert und Empfehlungen der AWMF zum Umgang mit Interessenkonflikten bei Fachgesellschaften herausgegeben.
Die rund 70 Fachgesellschaften und 2500 Experten, die für die AWMF hierzulande rein ehrenamtlich und ohne nennenswerte akademische Anerkennung mehrere hundert Leitlinien erstellen, müssen inzwischen detailliert aufführen, welche Interessenkonflikte ihr fachliches Urteil beeinträchtigen könnten.
 Die interdisziplinäre Arbeitsgruppe „Anatomie und Bildgebung“ um Dr. Anna Schober wurde für die Präsentation eines Lehrkonzeptes – Umgang mit CT und Röntgenbildern, in kleinen Gruppen und mithilfe von Tablet-Computern – nun mit dem Posterpreis der Gesellschaft für Medizinische Ausbildung (GMA) für die beste Visualisierung ausgezeichnet.
Die interdisziplinäre Arbeitsgruppe „Anatomie und Bildgebung“ um Dr. Anna Schober wurde für die Präsentation eines Lehrkonzeptes – Umgang mit CT und Röntgenbildern, in kleinen Gruppen und mithilfe von Tablet-Computern – nun mit dem Posterpreis der Gesellschaft für Medizinische Ausbildung (GMA) für die beste Visualisierung ausgezeichnet.