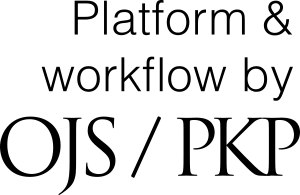„Ach Gott, jetzt fällt mir das Wort nicht ein, wenn evangelisch und katholisch zusammen …?“
Ansätze zum „Doing Ökumene“ in der Bahnhofsmission
DOI:
https://doi.org/10.17879/zpth-2024-6274Abstract
Bahnhofsmissionen sind niedrigschwellige Hilfseinrichtungen, die von Diakonie und Caritas getragen werden und sich selbst als „Ökumenische Einrichtungen“ verstehen. Der Beitrag gibt einen kurzen Überblick über die historische Entwicklung der ökumenischen Zusammenarbeit der Bahnhofsmission, fragt dann aber gezielt danach, wie Ökumene in der gegenwärtigen Arbeit konkret hergestellt und in actu vollzogen wird. Dazu wird mit der Praxistheorie eine Forschungsperspektive vorgeschlagen, die zur Untersuchung des Sozialen nicht mentale Eigenschaften oder Diskurse heranzieht, sondern dem Vollzug der Praxis eine eigene Qualität zugesteht. Für das „Doing Ökumene“ der Bahnhofsmission kann als Kernpraktik ein „Differenzmarking“ und als dahinterliegendes Backgroundphänomen ein „Kohärenzliving“ festgestellt werden. Differenzmarking bezieht sich auf die Betonung konfessioneller Unterschiede in der Praxis, wodurch die Gäste und Mitarbeiter*innen aber auch die Trägereinrichtungen gezielt in ihrer konfessionellen Identität angesprochen werden. „Kohärenzliving“ beschreibt hingegen den gelebten Zusammenhalt, der keine konfessionelle Trennung erkennen lässt. Die Bahnhofsmissionen zeigen sich in ihrer Praxis wesentlich durch die gemeinsamen Ziele und geteilten Werten wie „Nächstenliebe“ und „Menschenfreundlichkeit“ bestimmt. Diese stellen das unhintergehbare Gerüst des gelebten Zusammenhalts dar, sodass sogar Einrichtungen, die nur von einer Konfession getragen sind, eine Ökumene-Praxis erkennen lassen.
Am Beispiel der Bahnhofsmission wird damit gezeigt, wie der praxistheoretische Fokus auf die Ereignishaftigkeit, Materialität und Zeitlichkeit der Ökumene-Praxis insgesamt eine sinnvolle Weiterentwicklung für die Ökumenik sein kann, die den Hiatus zwischen trennender Lehre und verbindender Praxis heuristisch überbrückt.
Railway missions are low-threshold assistance facilities that are supported by Diakonie and Caritas and see themselves as “ecumenical institutions”. The article gives a brief overview of the historical development of ecumenical cooperation in the railway mission, but then asks specifically how ecumenism is actually established in current work. To this end, practice theory is proposed as a research perspective that does not draw on mental characteristics or discourses to examine the social, but instead grants the execution of practice its own quality. For the “doing ecumenism” of the railway mission, “difference marking” can be identified as a core practice and “coherence living” as an underlying background phenomenon. “Difference marking” refers to the emphasis on denominational differences in practice, whereby guests, employees and also the institutions are specifically addressed in their denominational identity. “Coherence living” describes the lived cohesion that does not reveal any denominational separation. In their practice, the railway missions are essentially defined by common goals and shared values such as “charity” and “philanthropy”. These represent the inescapable framework of lived cohesion, so that even institutions that are supported by only one denomination can recognize an ecumenical practice.
The example of the railway mission thus shows how the practice-theoretical focus on the eventfulness, materiality and temporality of ecumenical practice as a whole can be a meaningful further development for ecumenism, which heuristically bridges the hiatus between divisive doctrine and unifying life.