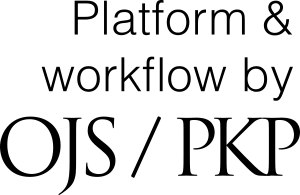Das „Wir“ als Herausforderung für die Kontextualisierung theologischer Wissensproduktion
DOI:
https://doi.org/10.17879/zpth-2024-6268Abstract
„Wir“-Setzungen sind Selbstverständlichkeiten theologischen Schreibens und theologischer Wissensproduktion. Nichtsdestotrotz, gehen solche Setzungen mit einer gewissen Brisanz einher, wenn man bedenkt, dass jegliche Zugehörigkeits- oder Abgrenzungskategorien stets auch ein gewisses Risiko bergen, auszugrenzen und zu verschleiern. Der Artikel behandelt „Wir“-Setzungen als eine Form der Kontextualisierung theologischen Wissens, die häufig unbewusst geschieht und mit gewissen allgemeinen Risiken der Kontextualisierung einhergeht. Diese Risiken werden im Verlauf des Artikels dargestellt und schließlich mit der Kategorie der hauntedness (engl.) auf ihre Potenziale für eine Theologie hin analysiert, die den Anspruch hat, sich in den Dienst von je mehr Gerechtigkeit und Gleichheit zu stellen.
Even though it is an omnipresent practice to invoke a (potentially undefined) “We” in theological writing, there is a risk to it, considering the exclusionary and concealing mechanisms that go along with any kind of declarations of belonging. The article unfolds the declaration of “We”s as a form of contextualising theological knowledge, that oftentimes happens unwittingly, while at the same time demonstrating challenges that go hand in hand with any kind of contextualisation. Ultimately these implications that come with presupposing “We”s are analyzed along the category of hauntedness, in order to access the potential this category holds for doing theology in service of ever more justice and equality.