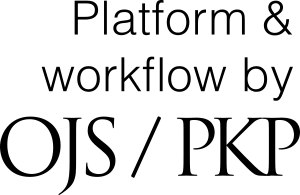Call for Papers 2024 – Nachhaltige landwirtschaftliche Transformationen – soziologische Perspektiven
Die moderne Landwirtschaft, deren Strukturen sich parallel zur Industrialisierung und der Herausbildung von Wohlfahrtstaaten im globalen Norden entwickelt haben, steht aktuell vor grundsätzlichen Umbrüchen.
Zwar wurden durch die wissensbasierte Intensivierung der Landwirtschaft eine historisch bis dahin ungekannt selbstverständliche Ernährungssicherung sowie die Herstellung kostengünstiger agrarischer Erzeugnisse bei geringer Bindung von Arbeitskräften ermöglicht (vgl. etwa Ahrens 2022, Bundesamt 2021). Jedoch werden in verschiedenen Bereichen unwillkommene Folgen moderner Landwirtschaft diagnostiziert und diskutiert (Kussin und Berstermann 2022: 8-15). Es sind dies zunächst ökologische Folgen in Form von Überschreitungen ökologischer Grenzen, von Bodendegradation über Biodiversitätsverlust bis hin zur Schadstoffbelastung von Gewässern und Nahrungsmitteln (Heißenhuber/Heber et al. 2015). Weiter erweisen sich Folgen für die menschliche Gesundheit, die zum einen an Lebensmittelkrisen und -skandalen (u.a. Glykolweinskandal, BSE-Krise, Dioxinskandal) festgemacht werden, zum anderen aber auch an gesundheitsschädlichen Rückständen von Substanzen, die in der modernen Landwirtschaft Anwendung finden und Nahrungsmittel verunreinigen (KATALYSE Institut 1995). Darüber hinaus werden Folgen für das Tierwohl durch intensive Haltungsformen diskutiert, deren Ausmaß, Ausgestaltung und grundsätzliche moralische Vertretbarkeit in Öffentlichkeit und Politik kontrovers sind (Von Gall 2016: 39). Schließlich zeigen sich zunehmend soziale Folgen innerhalb der Landwirtschaft selbst, die sich an wachsenden Arbeitsbelastungen, immer größeren Investitionsrisiken und anderen Unsicherheitsfaktoren der Betriebe manifestieren (Meuwissen/Feindt et al. 2019). Die Protestaktionen der Landwirtinnen und Landwirte der jüngsten Vergangenheit in Deutschland aber auch anderen Ländern mit modernen Agrarstrukturen wie Frankreich und den Niederlanden verdeutlichen, in welcher Weise die mit diesen Themen verbundenen Dilemmata und Konsequenzen in der Landwirtschaft selbst Resonanz auslösen (Heinze et al. 2021).
Zwar werden die Diskussionen in diesen Themenfeldern bereits zum Teil seit den 1960er Jahren in wechselnder Intensität und unter Änderung von Aufmerksamkeitsschwerpunkten geführt. Gleichwohl zeigen Veröffentlichungen wie das Gutachten „Landwende im Anthropozän“ des Wissenschaftlichen Beirats der Bundesregierung für Globale Umweltveränderungen (WBGU 2020), dass die Forderung nach einer grundlegenden Änderung der agrarischen Landnutzung aus den Klima- und Umweltwissenschaften erst seit den vergangenen Jahren in besonderer Einmütigkeit und Eindringlichkeit an Politik und Wirtschaft adressiert und dort auch aufgegriffen werden. Dies gilt ebenso für den Bereich der Nutztierhaltung, in dem bisherige Formen intensiver Tierhaltung auch von Teilen der Agrarwissenschaften selbst in Frage gestellt werden (BMEL 2015). Neben der Wissenschaft beschäftigte sich eine eigens eingerichtete „Zukunftskommission Landwirtschaft“ in Deutschland mit der Frage, wie ein solcher Wandel für die Landwirtschaft aussehen kann und entwarf dazu verschiedene Szenarien (Zukunftskommission 2021). Eine Transformation der landwirtschaftlichen Produktion und Produktionsbedingungen erscheint – wie vor diesem Hintergrund deutlich – unabwendbar und findet in Teilbereichen bereits statt. Zugleich ist jedoch die Frage umstritten, inwieweit die Art und Richtung dieser Transformation gestaltet werden soll und kann.
Die Vielfalt sich aufdrängender ökologischer, sozialer und ökonomischer Herausforderungen und Schwierigkeiten geht einher mit einer sich offenbarenden Brüchigkeit des herkömmlichen agrarischen Reflexionswissens – des Wissens also, mit Hilfe dessen das agrarische Feld sich selbst sowie seine Umwelt beschreibt und das bisher handlungsanleitend für die agrarische Praxis war. Die Brüchigkeit des agrarischen Reflexionswissens manifestiert sich darin, dass trotz der enormen Wissensintensität dieses Feldes angesichts der genannten Probleme und Gefährdungen – vielfältige ökologische Grenzen einerseits, betriebliche Herausforderungen andererseits bei gleichzeitig gestiegenen gesellschaftlichen Anforderungen – eine integrative Problemdiagnose und Transformationsperspektive nach wie vor unterthematisiert bleibt. Hinzu kommt, dass ökologische und betrieblich relevante Schäden unintendierte Folgen der Anwendung agrarwissenschaftlichen Wissens sind, welches aber Landwirt*innen bisher von Expert*innen und Berater*innen nahegelegt wurde. Fehlende Nachhaltigkeit und Resilienz bis hin zu massiver Gefährdung der agrarischen Erzeugung durch Bodenerosion oder massiven Schäden in als Monokulturen bewirtschafteten agrarischen Kulturen und Forsten sind dafür nur die offensichtlichsten Beispiele. Die Differenz von Risiko und Gefahr (Luhmann 1993) gewinnt damit eine neue, geradenach zynische Dimension, indem die Verursachung von Schäden zwar auf eigene (riskante) Entscheidungen (der Landwirte) zurückgeht, diese jedoch durch Dritte (wissenschaftsbasierte Beratung) in eine (gefährdende) Richtung motiviert wurden. Gleichzeitig bleiben trotz dieser offensichtlichen Brüchigkeit des agrarischen Reflexionswissens landwirtschaftliche Praxis und ihre agrarpolitische Regulierung auf wissenschaftliches Wissen angewiesen, was zweifellos ebenso zu Verhärtungen im Diskurs um die Zukunft der Landwirtschaft beiträgt. Das agrarische Feld steht daher vor der Herausforderung, die eigene Wissensbasis zu reflektieren und perspektivisch zu erweitern.
In dieser Gesamtkonstellation sind die Soziologie und insbesondere eine Soziologie der Nachhaltigkeit aufgefordert, ihre Perspektiven zur Reflexion der agrarischen Wissensbasis und Gestaltung dieser Transformation einzubringen. Untersuchungen zum gesellschaftlichen Wandel, zum Verhältnis von Materialität und Sozialität, zu in Praktiken eingebundenen Strukturen und Handlungen, zu Wissenskulturen, zum Verhältnis von Wirtschaft und Gesellschaft oder dem Wandel von Organisationen und Institutionen sind in ihrer Relevanz für die Transformation der Landwirtschaft offensichtlich. Umgekehrt bietet sich das Themengebiet der Landwirtschaft für die Untersuchung nachhaltigkeitsbezogener Fragestellungen aus soziologischer Perspektive an, spitzen sich hier doch Zielkonflikte zunehmend zu Dilemmata zu (Henkel/Berg et al. 2023) und lassen sich aktuelle Konflikte doch nicht zuletzt als unterschiedliche Zukünfte (Adloff/Neckel 2019) lesen. Folgende Schwerpunkte sind im Rahmen dieses Sonderheftes besonders relevant:
Welche Zielkonflikte zeigen sich angesichts der Nachhaltigkeitsherausforderungen in der Landwirtschaft und welche soziologischen Erklärungsansätze bieten sich zu deren tiefergehendem Verständnis und Bearbeitung an?
Was kann eine Soziologie der Nachhaltigkeit beitragen, um das Spannungsfeld zwischen Landwirtschaft und Gesellschaft präziser zu umreißen und auf diese Weise auch vorschnelle Lösungsansätze aus anderen Disziplinen oder auch der Praxis herauszufordern?
Welche Ansätze soziologischer Forschung zur Transformation des Agrar- und Ernährungssystems finden sich zum Beispiel in einer Soziologie der Nachhaltigkeit, einer Soziologie der Digitalisierung, Techniksoziologie und Science and Technology Studies? Welche konkreten Aspekte wie Boden, Nutztiere, Pflanzen und Pflanzenbau oder Agrartechnik werden soziologisch behandelt?
Inwieweit bieten sich Ansätze der Organisationssoziologie oder der Forschung zu sozialen Bewegungen an, um landwirtschaftliche Betriebe und landwirtschaftliche Interessenvertretungen soziologisch zu untersuchen? Welche Perspektiven, Herausforderungen und Möglichkeiten bieten sich hier für die Soziologie?
Gastherausgeber*innen des Sonderbands sind Holli Gruber, Anna Henkel, Matthias Kussin und Laura Scheler. Sowohl empirische Arbeiten als auch theoretisch-reflexive Ansätze oder Übersichtsarbeiten zur Transformation des Land- und Ernährungssystems sind willkommen. Interessierte Autor*innen aus Wissenschaft und Praxis sind aufgefordert, bis zum 15.09.2024 Abstracts von etwa 1000 Wörtern (inkl. Literatur) einzureichen. Neben der Einreichung von Abstracts für Journalbeiträge in der SuN sind auch Vorschläge für Forschungsnotizen, Rezensionen und andere, kürzere Formate für den Begleit-Blog der SuN erwünscht. Alle Beitragsvorschläge können unter sun.redaktion(at)uni-muenster.de eingereicht werden.
Literaturverzeichnis
Adloff, F./Neckel, S. (2019): Futures of sustainability as modernization, transformation, and control: a conceptual framework. Sustainability Science, 14. Jg., S.1015-1025.
Ahrens, S. (2022): Anteil von Nahrungsmitteln und Getränke an Konsumausgaben in der EU nach Ländern 2021 bis 2022. Online: https://de.statista.com/statistik/daten/studie/301863/umfrage/konsumausgaben-fuer-nahrungsmittel-und-getraenke-im-europaweitem-vergleich [ Zugriff: 11.07.2023 ].
BMEL (2015): Wissenschaftlicher Beirat für Agrarpolitik beim BMEL: Wege zu einer gesellschaftlich akzeptierten Nutztierhaltung. Gutachten. Berichte über Landwirtschaft. In: Zeitschrift für Agrarpolitik und Landwirtschaft, Sonderheft 221. doi.org/10.12767/buel.v0i221.82
Heinze, R. G./Bieckmann, R./Kurtenbach, S./Küchler, A. (2021): Bauernproteste in Deutschland. Aktuelle Einblicke und politische Verortung. In: Forschungsjournal Soziale Bewegungen, 34. Jg., Heft 4, S. 360–379.
Heißenhuber, A./Heber, W./Krämer, C. (2015): Umweltprobleme der Landwirtschaft - eine Bilanz. 30 Jahre SRU-Sondergutachten. Dessau-Roßlau: Umweltbundesamt.
Henkel, A./Berg, S./Mader, D./Müller, A.-K./Bergmann, M./Gruber, H./Siebenhüner, B./Speck, K. (2023): Dilemmata der Nachhaltigkeit: Zur Relevanz und kritischen Reflexion in der Nachhaltigkeitsforschung – ein Leitfaden. Baden-Baden: Nomos.
KATALYSE Institut [Hrsg.] (1995): Neue Chemie in Lebensmitteln. Frankfurt am Main: Zweitausendeins.
Kussin, M./Berstermann, J. (2022): Agrarkommunikation. Eine Einführung in Theorie, Konzeption und Umsetzung. Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden; Imprint Springer Gabler (Springer eBook Collection).
Luhmann, N. (1993): Risiko und Gefahr. In: Krohn, W./Krücken G. [Hrsg.]: Riskante Technologien: Reflexion und Regulation. Einführung in die sozialwissenschaftliche Risikoforschung. Frankfrut: Suhrkamp, S. 138-185.
Meuwissen, M./Feindt, P./Spiegel, A./Termeer, C./Mathjis, E./Mey, Y./Finger, R./Balmann, A./Wauters, E./Urquhart, J./Vigani, M./Zwawalinska, K./Herrera, H./Nicholas-Davies, P./Hansson, H./Paas, W./Slijper, T./Coopmans, I./Vroege, W./Ciechomska, A./Accatina, F./Kopainsky, B./Poortvliet, M./Candel, J./Mayse, D./Severini, S./Senni, S./Sariono, B./Lagerkvist, C.-J./Peneva, M./Gavrilescu, C./Reidsma, P. (2019): A framework to assess the resilience of farming systems. Agricultural Systems, 176. Jg. doi.org/10.1016/j.agsy.2019.102656
Statistisches Bundesamt (2021): Land- und Forstwirtschaft, Fischerei. Arbeitskräfte und Berufsbildung der Betriebsleiter. Wiesbaden: Statistische Ämter des Bundes und der Länder.
Von Gall, P. (2016): Tierschutz als Agrarpolitik. Wie das deutsche Tierschutzgesetz der industriellen Tierhaltung den Weg bereitete. Bielefeld: transcript Verlag.
WBGU Wissenschaftlicher Beirat der Bundesregierung Globale Umweltveränderungen (2020): Landwende im Anthropozän: Von der Konkurrenz zur Integration. Berlin: WBGU.
Zukunftskommission (2021): Zukunft Landwirtschaft. Eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Empfehlungen der Zukunftskommission Landwirtschaft. Rangsdorf.