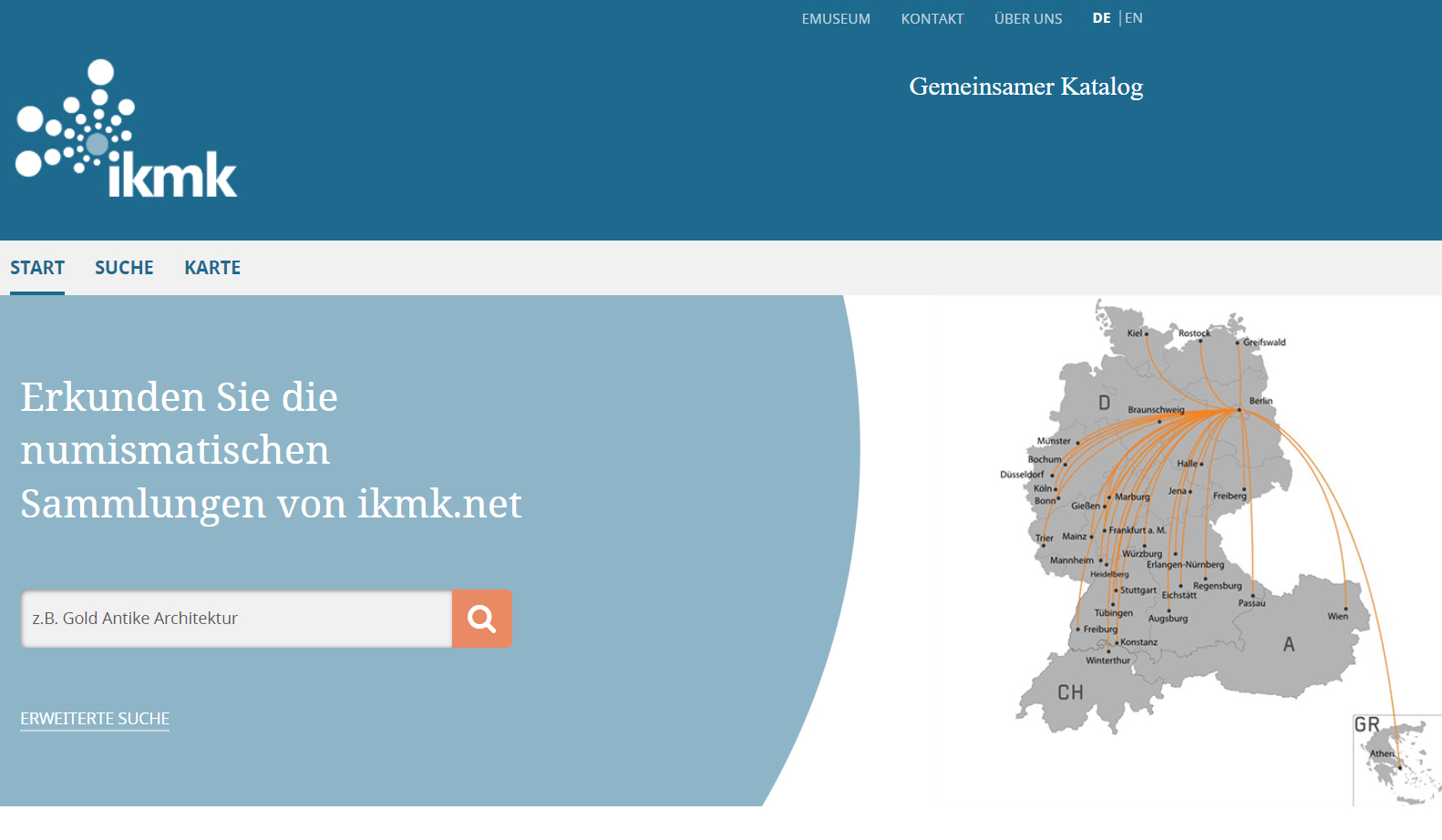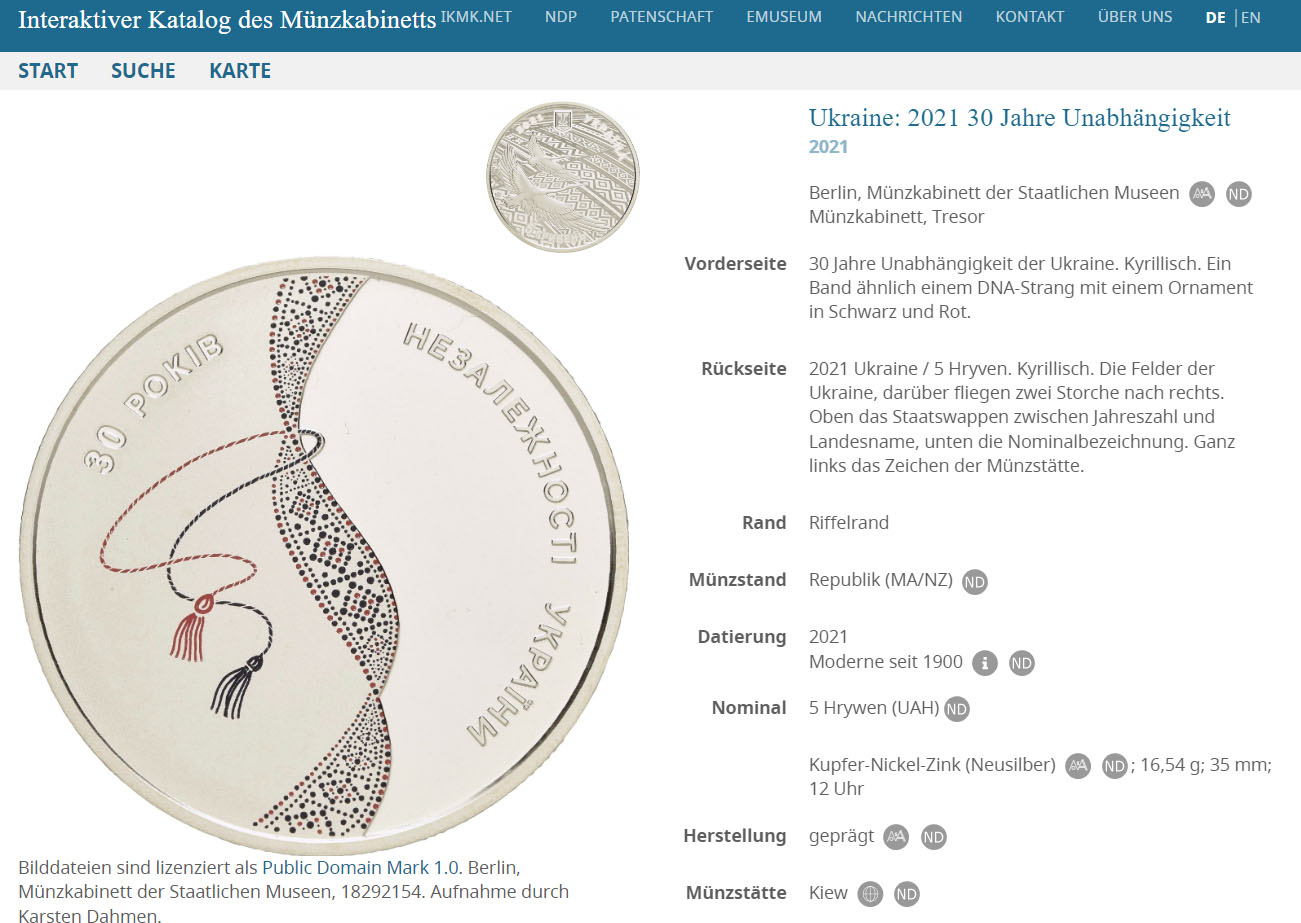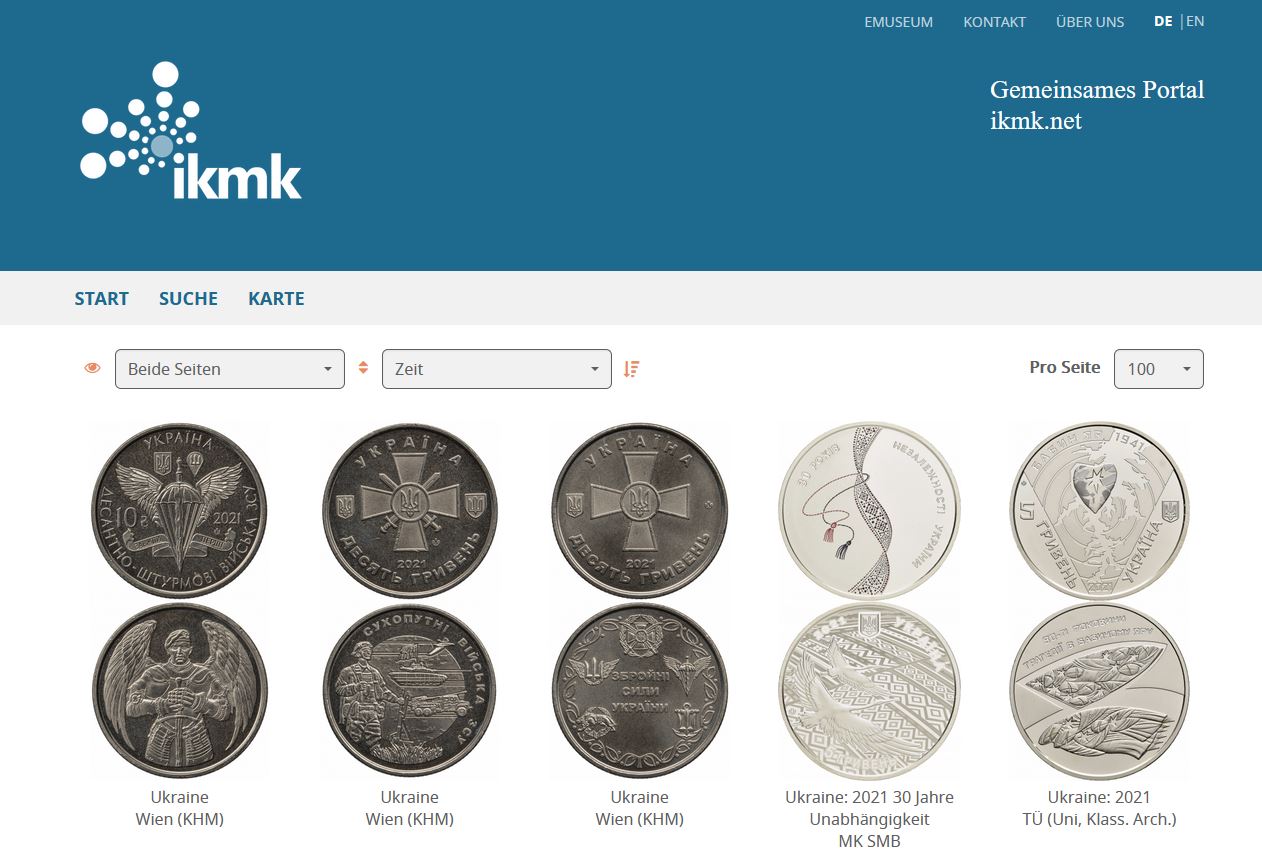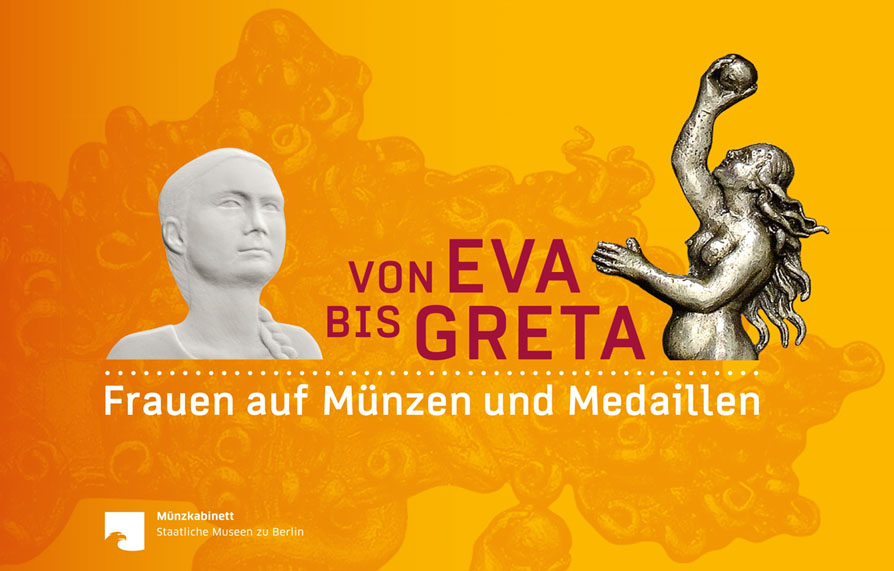Das Münzkabinett der Staatlichen Museen zu Berlin (Preußischer Kulturbesitz) in den Jahren 2021 und 2022
Vorbemerkungen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Prof. Dr. Bernhard Weisser,
Museumsdirektor (Münzen der Antike bis 3. Jh. n. Chr.,
Gesamtleitung IKMK). – Dr. Karsten Dahmen, Vertreter des
Direktors (Münzen der Spätantike und des Frühmittelalters,
Byzanz, Islam/Orient, ausländische Medaillen, Datenredaktion
IKMK, NDP). – Christian Stoess, M.A. (Münzen des Mittelalters,
der Neuzeit und Moderne, Europa und Übersee; Fotodokumentation).
– Dr. Johannes Eberhardt (Münzen und Medaillen der Neuzeit und
Moderne / deutschsprachiger Raum, Geldscheine und Wertpapiere,
historisches Stempelarchiv der Berliner Münzstätte, Bibliothek,
IT-Beauftragter)
Wissenschaftlicher Museumsassistent
in Fortbildung: Marjanko Pilekić, M.A. (bis 30.6.2021). – Julius
Roch, M.A. (ab 1.1.2022)
Restaurator: Dipl.-Restaurator (FH)
Jens Dornheim
Fotograf und Fotografin: Johannes
Kramer (10%, bis 30.3.2021). – Franziska Vu (10 %, seit
1.4.2021).
Sekretariat: Viola Gürke
Studiensaal und Bibliothek: Natalie
Osowski
Bildung und Vermittlung: Marie Fröde
(seit 1.8.2022, 10 %)
Projekte (zu den Zeiträumen genauer
dort): Stefanie Baars, M.A. – Dr. Angela Berthold. – Georgia
Bousia, M.A. – Andrea Gorys, M.A. – Paul Scott Höffgen, B.A. –
Marco Krüger, M.A. – Paula Michalski, B.A. – Matthias Naue. –
Johannes Peter, M.A. – Jan Peuckert, Ass. d. L. – Patrik Pohl,
M.A. – Sofie-Lilly Prinada, B.A. – PD Dr. Vladimir Stolba. –
Oksana Tokmina, B.A. – Diana Vegner, B.A.
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im
Ehrenamt: Prof. Dr. Jannis Hourmouziadis, Renate Vogel, M.A.,
Prof. Dr. Bernd Kluge, Dipl.-Phil. Elke Bannicke (bis Juli
2022), Horst Kosanke
Bernhard Weisser ist seit 2021
Vorsitzender der Numismatischen Kommission der Länder in der
Bundesrepublik Deutschland. Er wurde 2022 für eine zweite
Amtszeit in den Internationalen Numismatischen Rat gewählt. Er
ist im Beirat der Deutschen Gesellschaft für Medaillenkunst und
im Gremium zur Verleihung des Saltus Award. Er ist Mitglied im
wissenschaftlichen Beirat für das American Journal of
Numismatics. – Karsten Dahmen leitet den Freundeskreis Antike
Münzen (FAM). Er ist, wie Weisser, Mitglied im
wissenschaftlichen Beirat
Notae Numismaticae – Zapiski Numizmatyczne,
Krakau und ist Preisrichter für die »Coin of the Year« von
Krause Publications. Er gehört der internationalen Arbeitsgruppe
zur Schaffung und Vereinheitlichung numismatischer Normdaten (www.nomisma.org)
an. Er ist Ombudsmann für gute wissenschaftliche Praxis für die
Stiftung Preußischer Kulturbesitz. – Christian Stoess ist
Präsident der Gesellschaft für Internationale Geldgeschichte und
Schatzmeister der Numismatischen Kommission der Länder. Er ist
wissenschaftlicher Beirat der Numismatic Association of
Australia und seit 2022 des Jahrbuchs für Numismatik und
Geldgeschichte. – Johannes Eberhardt ist Schriftführer der
Deutschen Gesellschaft für Medaillenkunst und Sprecher des
Berliner Medailleurkreises. Er wurde als numismatischer
Preisrichter in die Jury der Wettbewerbe zur Gestaltung der
deutschen Gedenkmünzen berufen und nahm im Jahr 2022 in München
an der Jurysitzung für FIDEM 2023 und den Deutschen
Medailleurpreis für 2023 teil. Er wurde in den
wissenschaftlichen Beirat der Rei Nummariae Scriptores gewählt.
– Dahmen, Eberhardt und Weisser gehören dem Vorstand der
Numismatischen Gesellschaft zu Berlin an, dem Förderverein des
Münzkabinetts.
Bernd Kluge wurde im Juni 2022 zum
Ehrenmitglied der Numismatischen Gesellschaft zu Berlin ernannt.
Dr. Sabine Schultz
(1.5.1937–31.12.2021) trat im April 1964 als wissenschaftliche
Mitarbeiterin im Münzkabinett Berlin ein. In ihre Zuständigkeit
fiel die bedeutende Sammlung der ca. 150.000 antiken Münzen
(Griechen, Römer, Kelten, Byzantiner, u. a.), deren Betreuung
sie sich mit ihrem Mann Hans-Dietrich Schultz teilte, welcher
diesen Sammlungsbereich leitete. Neben ihrer Tätigkeit am
Münzkabinett gelang es ihr, im Februar 1969 im Fach Klassische
Archäologie zu promovieren. Thema der Arbeit war die
kaiserzeitliche Münzprägung von Magnesia am Mäander. Gemeinsam
mit ihrem Mann richtete sie 1982 eine neue Dauerausstellung zur
antiken Münzprägung im Nordflügel des Pergamonmuseums ein, die
bis 2011 fortbestand. Sie veröffentlichte in der Zeitschrift
»Forschungen und Berichte«, in deren Redaktion sie seit 1978
mitarbeitete. Im Jahr 1984 begann die Arbeit an der Bestimmung
und Veröffentlichung der griechischen Münzen in der
Universitätsbibliothek Leipzig, die 1993 zu einem Band der
Sylloge Nummorum Graecorum führte. Sabine Schultz trat unter
Nutzung einer damals geltenden Regelung am 30. September 1992 in
den Vorruhestand. Seitdem ist die zweite Antikenstelle am
Münzkabinett unbesetzt.
Jürgen Morgenstern (17.5.1945–26.9.2021) engagierte sich seit 2011 als ehrenamtlicher Mitarbeiter an unserem Museum. Jürgen Morgenstern war ein ausgewiesener Experte für das Papiergeld und langjähriger Vorsitzender des Vereins der Deutschen Geldschein- und Wertpapiersammler. Für diesen Verein gab er regelmäßig die Information für Papiergeld & Wertpapiersammler heraus. Mit großer Freude und Leidenschaft hat er seit dem Jahr 2011 insgesamt 3.696 Geldscheine unserer Sammlung für den Interaktiven Katalog bearbeitet (Abb. 2). Der erste Geldschein, den er angelegt hat, stammte aus Angermünde mit dem Nominalwert ›Eine Million Mark‹ (Objektnummer 18226443). Am 25. Juli 2020 legte er den letzten Geldschein zu Greifenberg (Gryfice) zu 50 Pfennig aus dem Jahr 1921 an (Objektnummer 18270648).

Projekte
Corpus Nummorum Thracorum –
Klassifizierung der Münztypen und semantische Vernetzung über
nomisma.org (2017 bis 30. Juni 2022, Förderung:
DFG. Projektpartner: BBAW, Big Data Lab der Universität
Frankfurt). Im Rahmen des Projektes konnten alle thrakischen
Münzen im Besitz des Münzkabinetts veröffentlicht werden. Das
Münzkabinett war für die Typisierung der thrakischen Münzstätten
am Mittelmeer, der Propontis und auf der thrakischen Chersones
in
www.corpus-nummorum.eu zuständig und konnte
diese Arbeit abschließen. Es liegt nun eine feinteilige
Typologie für Thrakien vor. Beteiligte: Dr. Angela Berthold
(75%, bis 28.2.2021). – Georgia Bousia, M.A. (50%,
15.2.2021–30.6.2022). – Prof. Dr. Bernhard Weisser
CHANGE. The
development of the monetary economy of ancient Anatolia, c.
630–30 BC (seit September 2020,
Förderung: EU. Projektpartner: University of
Oxford, British Museum). Im Rahmen des Projektes wurden bislang
17.360 antike Münzen Kleinasiens fotografiert. Kerndaten wurden
für 11.815 Münzen angelegt. Seit Anfang 2022 werden die so
qualifizierten Basiseinträge auch im IKMK veröffentlicht. 2.012
Münzen der Regionen Paphlagonien, Bithynien, Lykien und der
Aeolis sind mittlerweile auf diese Weise online zugänglich.
Vollständig qualifiziert sind die Münzen von Pontos. Im Rahmen
des Projektes wurden zudem Cistophoren und die
vorkaiserzeitlichen Münzen von Elaia veröffentlicht. Beteiligte:
Prof. Dr. Bernhard Weisser. – Stefanie Baars, M.A. (seit
November 2020, wissenschaftliche Mitarbeiterin, 65%). – Paula
Michalski, B.A. (bis 31.7.2021, stud. Hilfskraft). – Jan
Peuckert, Ass. d. L. (seit Sept. 2020, stud. Hilfskraft). –
Sofie-Lilly Prinada, B.A. (seit Sept. 2021, stud. Hilfskraft)
Normdaten und Münzerwerbungen
zwischen 1933 und 1945 (März bis Dezember 2021,
Förderin: Beauftragte für Kultur und Medien).
Normdatenerstellung zu den in den Accessionsbüchern erfassten
Vorbesitzern und Veräußerern sowie Prüfung der
Erwerbungsvorgänge aus diesem Zeitraum. Im November wurde ein
Kolloquium zum Thema mit Provenienzforscher*innen und
Münzsammlungen veranstaltet. Die Ergebnisse wurden im September
2022 als Sonderheft der Geldgeschichtlichen Nachrichten
veröffentlicht und auf dem Internationalen Numismatischen
Kongress verteilt. Beteiligte: Dr. Angela Berthold
(1.3.–30.6.2021, 75% und 1.7.–31.12.2021, 50%)
Der Fund von Ralswiek (Mai 2021 –
Februar 2022, Förderung: »Zielgerichtete
Digitalisierungsförderung« des Deutschen Bibliotheksverbandes).
Digitale Dokumentation und Veröffentlichung (überwiegend
Basiseinträge) von 2.213 islamischen Münzen des größten
derartigen Fundes in Deutschland, verborgen um 850 in Ralswiek
auf Rügen und entdeckt 1973 (Abb. 3). 100 Münzen dienten
2021 als Leihgaben für eine Ausstellung des Moesgaard-Museums in
Dänemark. Beteiligte: Christian Stoess, M.A. – Matthias Naue




Corpus Nummorum, Datenqualität für
Numismatik, basierend auf Natural Language Processing und
Neuronalen Netzen (D4N4) (seit Juli 2021,
Förderung: DFG, Projektpartner: BBAW, Big Data Lab der
Universität Frankfurt). Das Programm besteht aus dem Training
der KI zur Bilderkennung hinsichtlich der in Corpus Nummorum
erfassten thrakischen Münzen. Die automatisierte
Qualitätskontrolle wird verbessert. Im Rahmen des Projektes
wurde auch das 2015 erworbene Fotoarchiv der Firma Lübke &
Wiedemann aufgestellt (Abb. 4). Das digitale Fotoarchiv,
das auf einem Server der SMB liegt und 136 Terabyte umfasst,
wurde in Listenform verzeichnet. Somit besteht nun
Auskunftsfähigkeit über den Gesamtbestand des Archivs und
Anfragen können bearbeitet werden. 2022 wurden 1.225 Fotos des
digitalen Archivs in die Datenbank von Corpus Nummorum
integriert. Dabei hilft die Erhöhung der Menge der zu einem Typ
zugeordneten Münzen nicht nur der Künstlichen Intelligenz als
Trainingsmaterial, sondern bietet auch aus numismatischer Sicht
die Möglichkeit neuer Erkenntnisgewinne. So finden sich immer
wieder neue bislang unbekannte und nicht verzeichnete Münztypen
unter den Auktionsfotos. Auch können sich durch die Vermehrung
und dadurch bedingte Präzisierung der technischen Angaben zu
Gewicht und Umfang der Münzen eines Typs metrologische Fragen zu
Nominal und Münzfuß klären lassen. Die Eingabe von Münzen
Mysiens und der Troas wurde fortgesetzt. 2021 fand eine Reise zu
den Münzstätten Mysiens und der Troas statt (Gorys, Weisser) und
2022 die Teilnahme an der Ausgrabung in Assos zur
Fundmünzenbearbeitung (Gorys, Peuckert, Weisser). Beteiligte:
Prof. Dr. Bernhard Weisser. – Dr. Angela Berthold
(1.7.–31.12.2021, 25%, ab 1.1.2022 75%), Mysien und Troas:
PD Dr. Vladimir Stolba (ab 1.10.2021, 75%). – Andrea Gorys, M.A.
(Finanzierung BBAW, 50%)
Welfische Kippermünzen
(Juni 2021 – Dezember 2022, Förderung: »Corona-Förderlinie« der
Ernst von Siemens Kunststiftung). Erfassung der 2.051 welfischen
Kippermünzen der Sammlung Dr. Dr. Ernst-Henri Balan (s. unten,
Erwerbungen). Beteiligte: Christian Stoess, M.A., Johannes Peter
M. A. (Juni bis Dezember 2021, Erfassung von 15 % der Objekte),
Marco Krüger, M.A. (Februar bis Dezember 2022, Erfassung von 85
% der Objekte).
Kipper- und Wipper
(seit September 2020, Förderung: Förderkreis des Münzkabinetts,
Ronus-Foundation). Ziel ist die Publikation von 3.000
Kippermünzen aller Münzstände des Münzkabinetts im IKMK (s. u.
Abb. 5). Beteiligte: Christian Stoess, M.A., Paul Scott Höffgen,
B.A. (studentische Hilfskraft). Im Berichtszeitraum wurden 2.000
Datensätze in der Datenbank angelegt, davon sind 1.000 im IKMK
veröffentlicht.
Sammlung Thomas
Würtenberger, Ius in nummis (seit 2021,
Förderung: Förderkreis des Münzkabinetts und Familie
Würtenberger). Seit 2021 wird dem Münzkabinett in Partien die
Sammlung »Ius in nummis« des Freiburger Rechtswissenschaftlers
Professor Dr. Thomas Würtenberger als Schenkung überlassen. Sie
umfasst den größten zusammenhängenden Bestand an Medaillen und
Münzen mit Bezügen zu Recht, Gerechtigkeit sowie Parlaments- und
Verfassungsgeschichte aus Privatbesitz. Die Förderung dient der
Unterstützung der Publikation der über 3.000 Medaillen
umfassenden Neuerwerbung im IKMK. Beteiligte: Dr. Johannes
Eberhardt, Patrik Pohl, M.A. (wissenschaftliche Hilfskraft, ab
1.5.2022), Renate Vogel, M.A., Oksana Tokmina, B.A., Diana
Vegner, B.A., Marco Krüger, M.A.
Digitale Transformation: IKMK,
IKMK.NET, NDP
Seit 20. Mai 2021 sind alle
Sammlungen, die mit dem System mk-edit arbeiten (dabei auch das
Kunsthistorische Museum in Wien, das Münzkabinett in Winterthur
sowie der NUMiD-Verbund), über ein gemeinsames Portal zu finden:
https://ikmk.net. Es ist mit 91.000 Objekten
gestartet und wies Ende 2022 bereits 116.005 Objekte auf. Es
handelt sich damit um das umfangreichste qualitätsgesicherte
numismatische Online-Portal im deutschsprachigen Raum (s.
ausführlicher unten
Literatur mit Nennung der beteiligten Sammlungen).
Im Jahr 2022 kam die Universität Köln, Institut für
Altertumskunde (Lehrstuhl Peter Franz Mittag) als weiterer
Partner dazu. Am 20. Mai 2022 gab es ein Treffen der beteiligten
Sammlungen mit einem öffentlichen Workshop im Kunsthistorischen
Museum in Wien. Ende 2022 bestand die IKMK-Familie aus 43
Sammlungen, die mit 37 mk-edits arbeiteten, von denen 30 bereits
online sind.
Insbesondere mit Blick auf die
Projektpartner und Nutzer außerhalb des deutschen Sprachraums
wurde verstärkt Wert auf Mehrsprachigkeit gelegt. War bisher die
Oberfläche eines jeden IKMK mit den jeweiligen Feldnamen bereits
zwischen deutscher und englischer Sprache umschaltbar, so ist im
Verlauf des Jahres die bisher allein auf Deutsch erfolgte
Ansetzung der Konzeptbegriffe (z. B. der Name einer Münzstätte,
die Bezeichnung der Zugangsart oder eine Materialbezeichnung)
auch auf Englisch hinterlegt. Zudem ist es nun möglich, die
Freitextbeschreibungstexte der Felder Titeleintrag, Beschreibung
Vorderseite und Rückseite sowie Literatur, Kommentar und
Datierung verbale mittels eines Zusatzfeatures neben der
Standardeinstellung Deutsch auch als englischen, französischen
oder neugriechischen Text mittels eines Sprachlabels
auszuweisen, und damit sowohl exportfähig als auch im lokalen
IKMK zuschaltbar zu machen. Auf diese Art ergänzen sich in
Sachen Mehrsprachigkeit die zentral vorgehaltenen
Identifikatoren/Konzeptbezeichnungen mit den individuell zu
gestaltenden Freitexten.
Größere intensive Veränderungen, die
allen Partnern zugutekommen, betrafen Fragen zum Urheberrecht
und die Möglichkeiten einer individuellen
Bildrechteverwaltung. Seit Ende 2022
stehen die meisten Bilder des IKMK Berlin unter der Lizenz
»Public Domain Mark 1.0«, was bedeutet, dass sie unter Wahrung
der Zitation gebührenfrei verwendet und etwa auch in Wikidata
exportiert werden können. Das Münzkabinett war an einer neuen
entsprechenden Open Science Erklärung der Stiftung Preußischer
Kulturbesitz beteiligt (November 2021,
Onlinefassung).
Seit November 2021 werden im IKMK
Berlin auch sog. Basiseinträge veröffentlicht. Die Anzahl der
online ausgegebenen Datenfelder (und damit der zu deren
Ausfüllung benötige Zeitaufwand) ist hier im Gegensatz zum
vollständigen ›grünen‹ Datensatz deutlich reduziert. Die neue
Freigabekategorie des Basiseintrages
(sogenannter
gelber Eintrag) kombiniert die Angabe
wesentlicher Objektkerndaten (Erwerbungsnummer, Gewicht,
Durchmesser, Stempelstellung, digitale Aufnahmen,
Fotografenname, Aufnahmedatum) mit den Ausgabe- und
Exportmöglichkeiten eines regulären IKMK-Eintrages sowie einer
Zitierfähigkeit des jeweiligen Objekteintrages
mittels eines Permalinks. Ende 2022 waren von den 49.945 im IKMK
publizierten Objekten 4.785 Basiseinträge (2020: 39.841; 2021:
42.664, davon 194 Basiseinträge).
Das Normdatenportal
NDP
ist weiter gewachsen: bei den Personendaten auf 13.417 (2020:
11.062; 2021: 12.025), den Geographica auf 3.774 (2020: 3.307;
2021: 3.473) und den Nominalen auf 2.281 (2020: 1.763; 2021:
1.892). Insgesamt sind derzeit 20.103 Konzepte angelegt (2021:
17.781). Diese Arbeit kommt der ganzen IKMK-Familie zugute und
bietet die Grundlage für Kontextualisierungen im IKMK.NET. Die
Zusammenarbeit mit den IKMK-Sammlungen, Weiterentwicklungen
sowie die Endredaktion der museumseigenen IKMK-Einträge und die
Betreuung des Normdatenportals bildeten 2021 und 2022
Arbeitsschwerpunkte für Karsten Dahmen.
Erwerbungen (Abb. 5–10)
Insgesamt belief sich der
Sammlungszuwachs im Jahr 2021 auf 2.545 Accessionsnummern und
4.050 Objekte und 2022 auf 493 Münzen und andere numismatische
Objekte, darunter:
|
|
2021 |
2022 |
|---|---|---|
|
Münzen: |
2.055 |
108 |
|
Orden |
1 |
0 |
|
Medaillen, Modelle sowie
Marken und Zeichen |
1.994 |
385 |
Von den insgesamt 81
Erwerbungsvorgängen (2021: 40; 2022: 41) waren 42 Ankäufe, meist
von zeitgenössischen Kunstmedaillen, drei Überweisungen und 36
Schenkungen. Für die Bereiche Antike und für das Mittelalter gab
es keine Zuwächse. Für den Bestand zur Völkerwanderungszeit
konnte ein pseudoimperialer Drittelsolidus des 6. Jahrhunderts
erworben werden (Objektnummer
18281843). Neuzeitliche Münzen, Medaillen sowie
Marken und Zeichen waren mit 2.479 Exemplaren vertreten.
Mit maßgeblicher Unterstützung der
Ronus-Foundation in Los Angeles gelang im August 2021 der Ankauf
von 2.051 Kippermünzen aus der Sammlung Dr. Dr. Ernst-Henri
Balan (1938–2020), des langjährigen Ehrenvorsitzenden der
Numismatischen Gesellschaft zu Berlin. Sie umfasst Prägungen
Friedrich Ulrichs von Braunschweig-Wolfenbüttel und anderer
welfischer Herrscher (Abb. 5). Das Münzkabinett Berlin
verfügte schon vor der Erwerbung der Sammlung Balan über eine
wichtige Sammlung von welfischen Kippermünzen, immerhin 650
Stück. Der nunmehr 2.700 Münzen dieses Bereichs umfassende
Bestand bietet die Möglichkeit zur breiten Dokumentation der
Erzeugnisse des größten deutschen Kippermünzherrn und der
anderen welfischen Herzöge.


Medaillen und Modelle machen mit
1.958 Objekten einen Schwerpunkt des Erwerbungsjahres 2021 aus.
Die Inventarisierung der dem Münzkabinett in mehreren Tranchen
übergebenen Sammlung von Thomas Würtenberger »Ius in nummis«
umfasst nun die ersten 744 Objekte von insgesamt über 3.000
Stücken. Diese wurden bis Anfang 2023 dem Münzkabinett übergeben
und sukzessive accessioniert. Auch die Vorbereitung der
Ausstellung »Hand Große Kunst. Medaillenkunst in Deutschland
2007 bis heute« sorgte neben der Erwerbung der Sammlung
Würtenberger für einen wichtigen Impuls in der aktuellen
Erwerbungsstrategie des Münzkabinetts. Der Großteil der
Medaillenerwerbungen betraf Direktankäufe von zeitgenössischen
deutschen Medailleuren, die sämtlich mit Haushaltsmitteln
(›Ankauf moderne Kunst‹) bezahlt wurden (Abb. 9–10).
Weitere Geschenke für den Bestand des
Münzkabinetts werden Bodo Broschat, Marianne Dietz (Abb. 8),
Dr. Johannes Eberhardt, Sonja Eschefeld, Kathrin und Lutz
Fahron, Dr. Rainer Grund, Helga Haub (Abb. 6–7), Heinz
Hoyer, Andreas A. Jähnig, Dr. Douglas N. Nicol, Manfred Olding,
Dr. Dieter Scholz, Christian Stoess, Dr. Stefan Wiesekopieter,
dem Archäologischen Labor der Universität Valencia, der
Gesellschaft für Internationale Geldgeschichte, der Firma Fritz
Rudolf Künker (Abb. 11–12), dem Nachlass Johannes Henke
und der Numismatischen Gesellschaft zu Berlin verdankt.





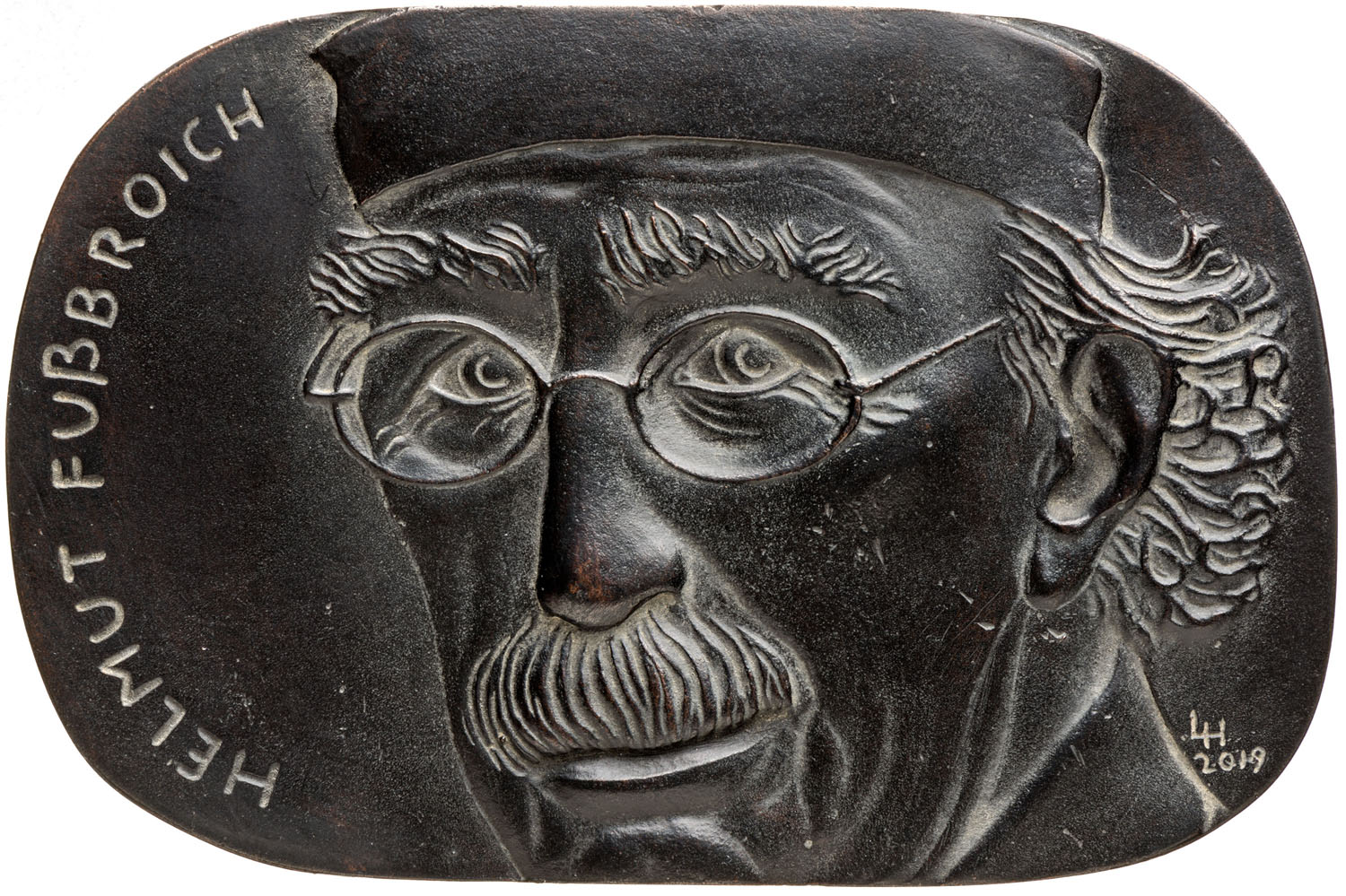

Social Media
Bernhard Weisser, Johannes Eberhardt,
Karsten Dahmen, Marjanko Pilekić und Julius Roch berichteten auf
Twitter über die Arbeit im Münzkabinett. Diese Form der
Öffentlichkeitsarbeit erfreut sich wachsender Beliebtheit.
Karsten Dahmen pflegt die
Nachrichtenseiten
des IKMK und der
Numismatischen Gesellschaft zu Berlin,
Johannes Eberhardt die Webseite der
Deutschen
Gesellschaft für Medaillenkunst und Christian
Stoess die Webseite der
Numismatischen Kommission. Mitarbeitende
beteiligten sich an
Numisvlogs, einer innovativen Form der
Vermittlung von Numismatik und schöne Momentaufnahme von der
Lebendigkeit des Faches im Jahr 2021.
Sammlungen
Die Münzen aus Thrakien sind nun
komplett digital veröffentlicht. Nikolaus Schindel hat den
Bestand sasanidischer Münzen unter Khusro I. publiziert.
Fortgesetzt wurden Arbeiten an den Münzen aus Mysien, der Troas
und aus Moesia Inferior. Die Erfassung der Kerndaten zu den
vorkaiserzeitlichen Münzen Kleinasiens wurde fortgeführt.
Begonnen wurde mit der Dokumentation der sog. Kipper und Wipper
sowie der Neuerwerbungen aus der Sammlung »Ius in nummis« von
Thomas Würtenberger. Alle Wissenschaftler dokumentierten Objekte
im Interaktiven Katalog des Münzkabinetts. Die
Provenienzforschung betraf ungezählte Einzelrecherchen. Im
Übrigen wurde die Arbeit an der Sammlung stark bestimmt durch
Materialvorlagen im Studiensaal, Anfragen, Leihersuchen und
Fotowünschen, wobei jeweils parallel die Eingabe dieser Objekte
in den Interaktiven Katalog IKMK erfolgte. Darüberhinausgehende
Arbeiten waren eigenen Wissenschaftsvorhaben gewidmet (s. dort).
a) Digitalfotografie (Ch.
Stoess, F. Vu)
Franziska Vu fertigte pro Jahr
jeweils ca. 400 qualitätvolle Aufnahmen und begleitete
Veranstaltungen des Münzkabinetts fotografisch. Mit Stand 2022
gibt es 7.463 Ladensicherungsbilder (2020: 7.110).
Die Zahl der fotografierten Objekte
ist in den Jahren 2021 und 2022 von 84.537 auf 120.660 Stück
gestiegen (3.494 Laden, davon 1.836 Antike und 1.658
Mittelalter/Neuzeit). Damit wurden in beiden Jahren gut 36.000
Objekte (2020: 24.000 Objekte) neu mit dem System Quickpx
erfasst (Abb. 14). Zu den Zuwächsen trugen das
CHANGE-Projekt (vorkaiserzeitliche Münzen Kleinasiens), das
Kipperprojekt, die Erwerbung Balan, der Fund von Ralswiek sowie
die Schenkung Würtenberger im Rahmen von Drittmittelprojekten
und durch Spenden finanzierte Projekte bei. Wie schon letztes
Jahr bleibt festzuhalten, dass die fotografische Dokumentation
unserer Sammlung eine unserer Kernaufgaben ist, aber aus dem
laufenden Etat des MK nicht zu leisten ist. Um weiterhin in
einem überschaubaren Zeitrahmen die Sicherheitsfotografie
voranzutreiben, ist eine deutlich bessere personelle und
finanzielle Ausstattung notwendig.
Sicherheitsfotografie (Stand 7.12.2022)
|
|
Antike |
MA/NZ/Medaillen |
Fremdbestände und Gipse |
|
Objekte 2021 / 2022 |
48.060 / 53.830 |
44.488 / 50.696 |
14.341 / 14.666 |
|
Laden 2021 / 2022 |
865 / 971 |
775 / 883 |
- |
Unser Quickpx-System kam nicht nur in der eigenen
Sammlung zum Einsatz, sondern wurde auch von anderen Museen
(Wegemuseum Wusterhausen) und in der türkischen Ausgrabung von
Assos verwendet. Ergänzend wurden in zwei Fotokampagnen der
Firma Lübke & Wiedemann 1.822 (2021) / 1.660 (2022) Objekte, für
die sich das hauseigene Fotosystem Quickpx nicht eignet,
aufgenommen (überwiegend Syrakus und italienische Medaillen).
Somit sind insgesamt 24.174 Objekte in 2021 und 15.431 in 2022
fotografisch erfasst worden.
b) Bibliothek, Studiensaal und
Archiv (D. Schatz, J. Eberhardt, N. Osowski)
Der Bestand ist in den Jahren 2021
und 2022 um 262 Monographien und 171 Bände Periodika gewachsen,
davon kamen 244 als Tausch- und Belegexemplare oder als
Schenkung in das Münzkabinett. Die Retrokonversion der
Bibliotheksbestände im OPAC der SMB-Bibliotheken umfasst nun
12.085 Titel. Die Bibliothekare der Kunstbibliothek der
Staatlichen Museen, Daniel Schatz und Elisabeth Scheele, haben
die Katalogisierung und Signierung der Bestände fortgesetzt, die
im Zuge dieser Arbeiten auch in neuer Ordnung aufgestellt werden
(Eberhardt). Die Besucherzahlen im von Natalie Osowski betreuten
Studiensaal näherten sich 2022 langsam wieder den Zahlen von
2019 (1.272): 2020: 621, 2021: 571 und 2022: 949. Im Archiv ist
die Einzelverzeichnung der Korrespondenz des Münzkabinetts ab
1933 jetzt bis zum Jahr 1941 gelangt (8.141 Blatt) und die
Bearbeitung wurde auf die Jahrgänge ab 1901 ausgeweitet. Die
Erwerbungsbücher von Julius Friedländer wurden im Zentralarchiv
gescannt. Außerdem wurde eine Weiterbildung zu »Archiven im
Informationszeitalter« an der FU Berlin erfolgreich absolviert
(Osowski).
c) Restaurierung (J. Dornheim)
Schwerpunkte im Bereich
Konservierung/Restaurierung/Kunsttechnologie am Münzkabinett der
Staatlichen Museen zu Berlin waren, neben der präventiven
Konservierung, die konservatorische und restauratorische
Betreuung des Sammlungsbestandes. In diesem Rahmen wurden im
Jahr 2021 838 und im Jahr 2022 549 Objekte auf ihren Zustand hin
überprüft. Daraus leiteten sich an 435 Objekten (2021: 163,
2022: 372) restauratorisch-konservatorische Maßnahmen ab. Dies
betraf insbesondere die Objekte zu Ausstellungen sowie die
Prägestempel des Hofrates Carl Wilhelm Becker (1772–1830).
Schadensbilder an den Stempeln waren in erster Linie partiell
auftretende Eisenkorrosionen, diese reichten von Flugrost bis
hin zu massiven Korrosionsprodukten (Abb. 15). Die
Korrosionserscheinungen wurden mechanisch entfernt bzw.
ausgedünnt, z.T. unter Zuhilfenahme geeigneter Lösemittel wie
Petroleum und Siedegrenzbenzin. Abschließend erfolgte eine
Konservierung mit mikrokristallinem Wachs. Für Ausstellungen
vorgesehene Münzen und Medaillen wurden vorab begutachtet und –
wo erforderlich – ebenfalls restauratorisch-konservatorisch
bearbeitet. In diesem Zusammenhang ist vor allem die
rheinland-pfälzische Landesausstellung »Hier stehe ich –
Gewissen und Protest – 1521 bis 2021« in Worms zu erwähnen.


Im Zusammenhang mit der Publikation
zum keltischen Münzfund aus Baitz (Brandenburg) durch Marjanko
Pilekić wurden die insgesamt 41 bildlosen, sogenannten glatten
Regenbogenschüsselchen (keltische Goldmünzen, ca. 125/115–50/30
v. Chr.) im Hinblick auf ihre Herstellungstechnik mikroskopisch
untersucht. Dabei konnte eindeutig festgestellt werden, dass die
an der äußeren Zone der Münz-Vorderseiten vorhandenen feinen
Strukturen (u. a. sog. Doppelschlag) während des Prägens
entstanden sind und kein zufälliges Ergebnis, z. B. resultierend
aus einem Gießprozess, darstellen (Abb. 16).
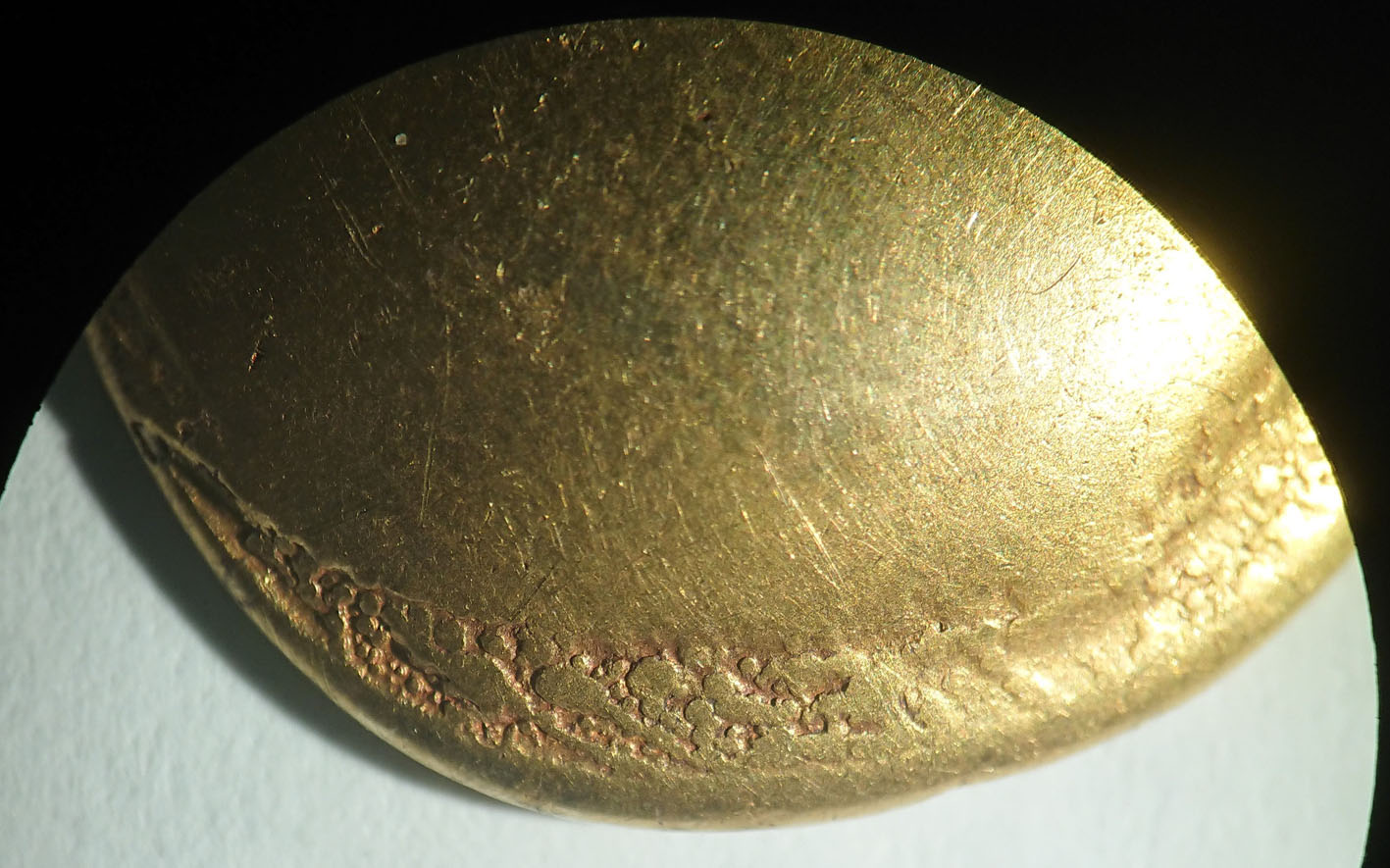
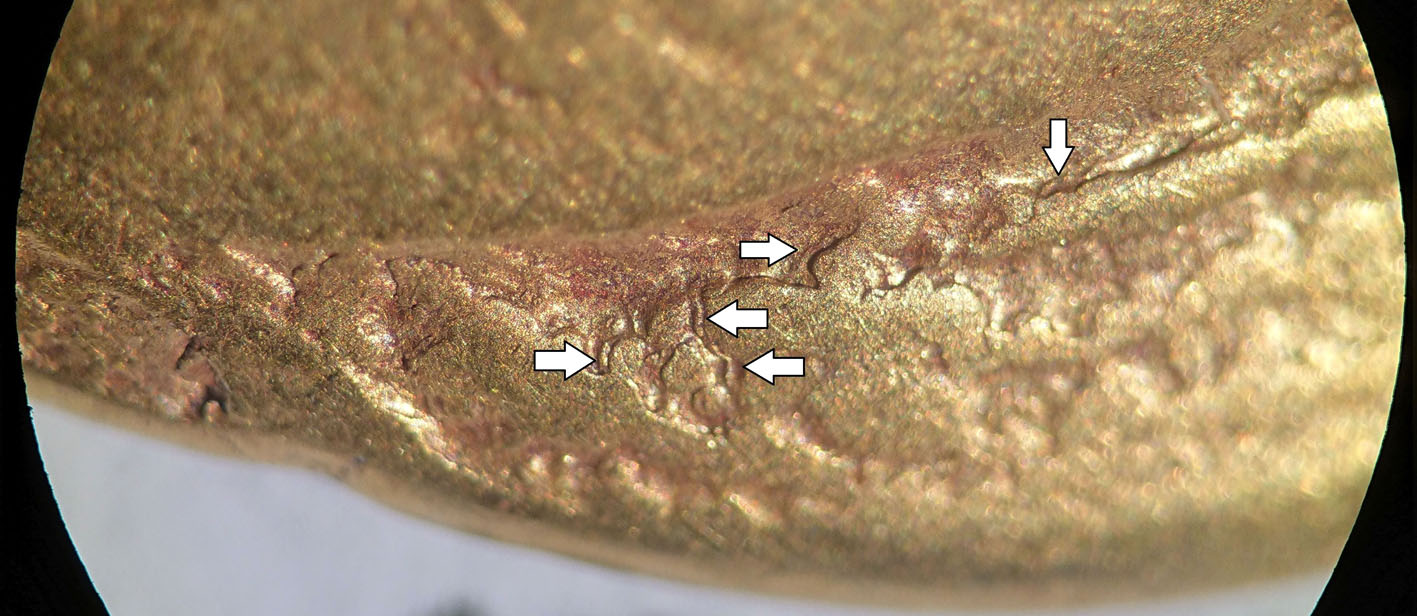
Im Rahmen ihrer Bachelor-Arbeit
beschäftigte sich Antonia Schürgens, Studentin der
Metallrestaurierung an der Fachhochschule Potsdam, mit dem ca.
2.400 Objekte umfassenden Münzfund von Samos (provinzialrömische
Antike, 2.–3. Jh. n. Chr.). A. Schürgens ging der
Restaurierungsgeschichte dieses Münzfundes nach, führte
naturwissenschaftliche Untersuchungen an den Münzen durch,
leitete daraus eine Konzeption für eine erneute Restaurierung
und Konservierung des Münzfundes ab und nahm an ausgewählten
Münzen exemplarisch Restaurierungs- und Konservierungsmaßnahmen
vor (Abb. 17).
d) Lehre und Qualifizierung
WS 2020/21: Prof. Dr. B. Weisser, Dr.
U. Peter und S. Baars, M.A.: Griechische Münzikonographie.
Humboldt-Universität, Institut für Klassische Archäologie.
WS 2021/22: Prof Dr. B. Weisser und
S. Baars, M.A.: Die antike Münzprägung in Kleinasien. Eine
Einführung. Humboldt-Universität, Institut für Klassische
Archäologie.
WS 2021/22: Dr. J. Eberhardt: IVS IN
NUMMIS. Eine Einführung für Historiker*innen.
Humboldt-Universität, Institut für Geschichtswissenschaften,
Lehrstuhl für Alte Geschichte (übergreifende Veranstaltung zur
Methodik).
SoSe 2022: Ch. Stoess, M.A.:
Numismatik des Spätmittelalters und der frühen Neuzeit.
Bestimmungsübungen. Humboldt-Universität, Institut für
Geschichtswissenschaften, Mittelalterliche Geschichte II.
WS 2022/23: Prof. Dr. B. Weisser und
J. Roch M. A.: Zeitenwende. Die neuen Bilder des Augustus.
Humboldt-Universität, Institut für Klassische Archäologie.
K. Dahmen und J. Eberhardt
veranstalteten Übungen und Blockseminare zur Numismatik mit
Studierenden der Universitäten Göttingen, Halle, Berlin und
Potsdam sowie mit Schülerinnen und Schülern des Europäisches
Gymnasium Bertha-von-Suttner, Berlin-Reinickendorf.
Abgeschlossen wurden die von B.
Weisser mitbetreuten Dissertationen von J. Roch (2021, Halle,
Zweitgutachter): »Die kaiserzeitliche Münzprägung Milets.
Fallstudie zur Entwicklung der Repräsentation, Perzeption und
Integration der römischen Autoritäten im kollektiven
Selbstverständnis der Städte Kleinasiens« und Hr.
Ivanova-Anaplioti (2022, HU Berlin, Erstgutachter): »Die
Münzprägung von Apollonia Pontike. Die Bildthemen einer
griechischen Polis im pontisch-thrakischen Raum«. J. Dornheim
betreute die Bachelor-Arbeit von A. Schürgens: »Exemplarische
Untersuchung und Analyse von bisher nicht identifizierten
Korrosionsphänomenen an antiken Bronzemünzen – mit
anschließender Suche und eventueller Durchführung von
stabilisierenden Maßnahmen«.
Forschungsstipendiatin der SPK: Esra
Tütüncü (Isparta, 2021/22) und Hanna-Lisa von Lenthe (Wien,
2022, Fortsetzung des durch die Pandemie unterbrochenen
Stipendiums von 2020).
Praktika (studienbegleitend): Paul
Seyfried (2021, Betreuer B. Weisser), Johannes Victor (2021,
Betreuer K. Dahmen), Ronja Edelhäuser (2022, Betreuer K.
Dahmen), Jan Hendrik Giering (2022, Betreuer Ch. Stoess), und
Arthur Hampel (2022, Betreuer Ch. Stoess).
Schülerpraktika: Sarin Arnreiter
(2022, Betreuer J. Roch)
Veranstaltungen
Am 25. November 2021 veranstaltete
das Münzkabinett einen virtuellen Workshop zu »Münzsammlungen in
Deutschland zwischen 1933 und 1945. Erwerbungsquellen und
Normdaten«. Am XVI. Internationalen Numismatischen Kongress in
Warschau im September 2022 nahmen S. Baars, A. Berthold, K.
Dahmen (online), A. Gorys, P. S. Höffgen, P. Pohl, V. Stolba,
Ch. Stoess, J. Roch und B. Weisser teil. Am 16. Tag der antiken
Numismatik in Münster nahmen S. Baars, A. Gorys, P. S. Höffgen,
P. Pohl, J. Roch und B. Weisser teil. B. Weisser und Ch. Stoess
führten als Vorstandsmitglieder die Jahrestagungen der
Numismatischen Kommission der Länder durch (2021 online / 2022
in Hamburg). Ch. Stoess veranstaltete die Jahresversammlungen
der Gesellschaft für Internationale Geldgeschichte in Frankfurt.
Darüber hinaus hielten Vorträge u. a. J. Eberhardt in Bonn
(online), Freyburg (Unstrut), Kressbronn und Wittenberg, K.
Dahmen in Münster, New York (online), Wien und Würzburg
(online), J. Roch in Split (2022, online), Ch. Stoess in Leipzig
(online), Berlin, Bremen und Mainz, B. Weisser in Berlin,
Erfurt, Hamburg, Münster und Wien. Im Mai 2021 haben
Numismatische Kommission der Länder, Deutsche Numismatische
Gesellschaft und Deutsche Gesellschaft für Medaillenkunst mit
der monatlichen Reihe »Numismatik vernetzt« ein Format für
Videovorträge geschaffen, in dem Themen der Numismatik behandelt
werden, die kollaboratives Arbeiten und die Diskussion von
Methoden und Vorgehensweisen im Verbund zum Gegenstand haben.
Moderiert wurde die Reihe im ersten Jahr von B. Weisser. Im
Münzkabinett fanden nach der Corona-Pause erneut die
Veranstaltungen der Numismatischen Gesellschaft zu Berlin sowie
ihrer Arbeitskreise (Freundeskreis Antike Münzen, Berliner
Medailleurkreis) statt.
Ausstellungen
Eigene Sonderausstellungen
Von Eva bis Greta. Frauen auf
Münzen und Medaillen
Ausstellungskurator:
Dr. J. Eberhardt. 27.11.2020 bis 6.1.2022. Aus 2.500 Jahren
begegnet uns die Weiblichkeit auf Münzen und Medaillen. Den
ewigen anthropoiden Göttinnen werden alsbald lebendige Frauen
zur Seite gestellt. Zwischen Ursprungsvorstellung und Aktualität
– oder beispielsweise ›Eva‹ und ›Greta‹ – eröffnen sich
zahlreiche Facetten und Themenfelder. Neben Berühmtheiten wie
Kleopatra wurden in der Sonderausstellung ganz unterschiedliche
Bilder und Bedeutungen von Frauen, wie sie anhand von Münzen,
aber vor allem durch Medaillen erfahrbar sind, beleuchtet.
Frauen begegnen uns dabei nicht nur als Dargestellte oder
Auftraggeberin, sondern etwa auch als Gestalterin, Sammlerin
oder Wissenschaftlerin. Die Schau präsentierte neben Beständen
aus den Tresoren des Münzkabinetts insbesondere zwei
Künstlereditionen, die eigens für diese Ausstellung angefertigt
wurden. Die Arbeiten zum Jahresthema des Berliner
Medailleurkreises trafen hierbei auf Beiträge aus der Auslobung
des Nachwuchspreises für eine Kunstmedaille »Die Drei Grazien«.
In der Ausstellung wurde gefragt, inwieweit Münzen und Medaillen
durch andere Quellen geprägte Vorstellungen von Frauen in der
Gesellschaft bestätigen oder herausfordern können.
Hand Große Kunst. Aktuelle
Medaillenkunst in Deutschland
Ausstellungskurator: J. Eberhardt. Eröffnung 28. Januar 2022.
Das Jahr 2022 bot Gelegenheit, das Medaillenschaffen seit 2007
in Deutschland zu resümieren. Die Ausstellung baute als zweite
Station auf Vorarbeiten der Staatlichen Münzsammlung München auf
und aktualisierte die Medaillenschau um weitere Werke. Dabei
wählte das Münzkabinett ein von der Münchner Ausstellung
abweichendes Konzept. Ließen die bayrischen Kolleginnen und
Kollegen noch alphabetisch jede Künstlerin und jeden Künstler
selbst wählen, was gezeigt werden solle, entschied sich Berlin
für eine thematische Gliederung. Zu dem enzyklopädischen Zugang
gesellte sich so ein interpretierendes Diskussionsangebot.
Begleitet wurde die Ausstellung durch einen einwöchigen
Medailleursworkshop und einen Medaillentag am 29. September
2022.
Leihgaben für Dauer- und
Sonderausstellungen
Dauerausstellung: Haus der
Brandenburgisch-Preußischen Geschichte, Potsdam,
30.4.2022–31.12.2025, ein Objekt, für 14 Objekte wurden zur
Erstellung galvanoplastischer Nachbildungen von Münzen und
Medaillen aus dem Bestand des Münzkabinetts Silikonformen zur
Verfügung gestellt.
(2021) Geld und Glaube: Religio –
Westfälisches Museum für Religiöse Kultur GmbH Telgte,
19.4.2021–10.9.2021, sechs Objekte. – Nimm Platz: Stiftung
Humboldt Forum Berlin, 28.6.2021–15.4.2022, vier Objekte. –
Imagine Mozart/Mozart Bilder: Martin von Wagner Museum der
Universität Würzburg, 30.4.–23.7.2021, ein Objekt. – Hier stehe
ich. Gewissen und Protest 1521–2021: Museum der Stadt Worms im
Andreasstift, 24.6.2021–14.1.2022, vier Objekte. – Hand Große
Kunst: Staatliche Münzsammlung München, 5.3.2021–6.1.2022, sechs
Objekte. – Salamis 480. Die Griechen im Krieg gegen die Perser:
Staatliche Antikensammlung und Glyptothek München,
2.11.2021–25.3.2022, vier Objekte. – Iran, Kunst und Kultur aus
fünf Jahrtausenden: ISL – SMB, 4.12.2021–20.3.2022, neun
Objekte.
(2022) Mythos München 72. Die XX.
Olympischen Spiele: Staatliche Münzsammlung München,
4.1.2022–16.1.2023, zwei Objekte. – Bildwerke in Wachs, SBM –
SMB, 1.2.2022–31.7.2022, drei Objekte. – RUS – Vikings in the
east: Moesgaard Museum Højbjerg (DK), 19.1.–11.9.2022, 100
Objekte. – Karl-Marx und der Kapitalismus: Deutsches
Historisches Museum Berlin, 10.2.–21.8.2022, ein Objekt. –
Persia: Ancient Iran and the Classical World: Paul Getty Museum
Los Angeles, 6.4.– 8.8.2022, drei Objekte. – Medal (privately):
E. Hutten-Czapski Museum Kraków, 17.3.2022–24.4.2023, zwei
Objekte. – Arthur Storch (1870–1947) – ein Blick auf sein
vielfältiges Schaffen: Thüringer Landesmuseum Heidecksburg
Rudolstadt, 25.3.–9.9.2022, ein Objekt. – Schliemanns Welten.
Sein Leben. Seine Entdeckung. Sein Mythos: MVF – SMB,
13.4.2022–8.1.2023, 27 Objekte. – Wir träumten von nichts als
Aufklärung. Moses Mendelssohn in seiner Zeit: Jüdisches Museum
Berlin, 14.4.–11.9.2022, ein Objekt. – Latein. Tod oder
lebendig!?: Stiftung Kloster Dahlheim, LWL-Landesmuseum für
Klosterkultur, 12.5.2022–8.1.2023, zwei Objekte. – Das Pferd in
der Antike. Von Troja zu Olympia: Hippomaxx Westfälisches
Pferdemuseum im Zoo Münster, 16.6.–18.9.2022, zwölf Objekte. –
Der Untergang des Römischen Reiches: Rheinisches Landesmuseum
Trier, 25.6.–27.11.2022, sieben Objekte. – Der Untergang des
Römischen Reiches: das Erbe Roms, Visionen und Mythen in der
Kunst Europas: Stadtmuseum Simeonstift Trier, 25.6.–27.11.2022,
drei Objekte. – Think big! Gail Rothschild porträtiert
spätantike Textilfunde aus Ägypten: SBM – SMB,
17.7.2022–6.2.2023, ein Objekt. – Die Normannen – Eine
Geschichte von Mobilität, Eroberung und Innovation:
Reiss-Engelhorn-Museum Mannheim gGmbH Stiftungsmuseum,
18.9.2022–26.2.2023, 14 Objekte. – So muss die heilige Jungfrau
ihren Sitz entweihen sehen. Marienburg zwischen Politik und
Sacrum: Muzeum Zamkowe w Malborku (PL), 23.9.–31.12.2022, vier
Objekte. – 200. Todestag von Karl August von Hardenberg:
Stiftung Schloss Neuhardenberg, 24.9.–4.12.2022, drei Objekte. –
In:complete. Zerstört – Zerteilt – Ergänzt: KB – SMB,
29.9.2022–15.1.2023, zwei Objekte. – Die neuen Bilder des
Augustus. Macht und Medien im antiken Rom: Bucerius Kunstform
gemeinnützige GmbH Hamburg, 8.10.2022–15.1.2023, 59 Objekte. –
Vision Seemacht. Ein Marinestück für den Großen Kurfürsten:
Gemäldegalerie – SMB, 1.5.–14.6.2022, zwei Objekte. –
Barbarossa. Die Kunst der Herrschaft: LWL-Museum Münster,
28.10.2022–5.2.2023, sieben Objekte.


Förderverein, die Erivan und Helga
Haub-Stiftung und die Ronus Foundation
Der Förderkreis des Münzkabinetts in
der Numismatischen Gesellschaft zu Berlin (Sprecher Carl-Ludwig
Thiele), die Erivan und Helga Haub-Stiftung sowie die Ronus
Foundation trugen durch ihre Förderungen erheblich zum Gelingen
von oben genannten Projekten und Vorhaben bei. Dazu gehört die
Finanzierung für Arbeiten an den Beständen für: Paul Scott
Höffgen, B.A., Dipl.-Restauratorin Petra Hoffmann, Marco Krüger,
M.A., Patrik Pohl, M.A., Diana Vegner, B.A. und Oksana Tokmina,
B.A. Finanziert wurde der Transport der Münzkartei von Clemens
Emin Bosch (1889–1955), des Begründers der Alten Geschichte an
der Universität Istanbul. Unterstützt wurde auch die Erfassung
der Neuerwerbungen »Ius in nummis« und die Teilnahme an der
Grabungskampagne von Assos. Hervorzuheben sind besonders
großzügige Einzelspenden von Helga Haub und Robert Ronus (s.
o.). Letzterer ermöglichte nicht nur die Erwerbung der Sammlung
Balan, sondern beteiligt sich auch an den Kosten für deren
Publikation. Der Förderverein ermöglichte die Fortsetzung von
Arbeiten und gab die Anschubfinanzierung für neue
Forschungsprojekte.
[Bildnachweise: Abb. 1, 2, 11–13, 18:
Münzkabinett Berlin; Abb. 3: Karsten Dahmen; Abb. 4: Angela
Berthold; Abb. 5, 14: Christian Stoess, Abb. 6–7, 10: Johannes
Eberhardt; Abb. 8–9, 20: Franziska Vu; Abb. 15–16: Jens
Dornheim; Abb. 17: Bernhard Weisser; Abb. 19: Jan Hawemann; Abb.
21: Jens Dornheim