Das Münzkabinett, Staatliche Museen zu Berlin, im Jahr 2020
Was von dem Jahr 2020 bleiben wir, das ist
die neue Kabinettsgeschichte, die über einen längeren Zeitraum
entstanden ist und uns gezeigt hat, dass in vielen Bereichen
noch Forschungsbedarf besteht, wir andererseits im Zusammenspiel
mit unserem Interaktiven Katalog immer mehr Wissen zur
Sammlungsgeschichte dauerhaft festhalten.
Im Januar 2020 wurde das Corona-Virus zum
ersten Mal in Deutschland registriert. Zur Eindämmung der
Pandemie dient das Mittel des ›Lockdown‹. Das aus dem Englischen
stammende Wort Lockdown (›Abriegelung, Ausgangssperre‹) gehörte
zuvor nicht zu unserem Wortschatz. Nicht das eindeutigere Wort
Massenquarantäne wird genutzt, sondern ein zuvor im Zusammenhang
mit Pandemien nicht verwendeter Begriff (Neologismus). Ziel
dieser Maßnahmen ist es, die Begegnungen zwischen Menschen zu
minimieren, um so die Infektionsmöglichkeiten zu reduzieren. Die
Zahlen sind inzwischen (Ende Januar 2021) besser als in den
ersten Januarwochen, die Impfungen haben begonnen. Auf der
anderen Seite begünstigt die Jahreszeit die Ausbreitung, Sorgen
vor einer ansteckenderen Mutation herrschen und die Impfungen
werden erst im Laufe des Jahres ihre Wirkung entfalten. Selbst
der Numismatiker und Museumsmensch entwickelt zwangläufig
Interesse an diesen medizinischen Fragen und Diskussionen.
Museumsschließungen sind Folge der Absicht,
die Ausgangssperre wirksam werden zu lassen. Dabei spielt der
Umstand, dass für die Museumsbesucher umfängliche Maßnahmen zur
Kontaktvermeidung ergriffen wurden und uns kein Fall bekannt
ist, in dem ein Museum oder eine Museumsveranstaltung zum
›Hotspot‹ wurde, keine Rolle. Was soll ich in einer Stadt wie
Berlin im Winter unternehmen, wenn Museen, Theater und Clubs
geschlossen sind, wenn keine Veranstaltungen stattfinden dürfen,
wenn an vielen Orten ständig eine medizinische Maske getragen
werden soll? Mittlerweile wird auch anerkannt, dass öffentliche
Verkehrsmittel ein Ansteckungsrisiko bieten. Der Weg zur Arbeit
dauert in Berlin im Durchschnitt eine Stunde, und dieser Weg
erfolgt überwiegend mit Hilfe öffentlicher Verkehrsmittel.
Konsequenterweise müssen wir nun begründen, warum Mitarbeiter
nicht in das Home-Office gehen können. Dabei schätzen wir es,
dass der Arbeitgeber über die gesamte Zeit den individuellen
Lebenssituationen (Risikogruppe, ›Homeschooling‹ u.a.) Rechnung
trägt.
In dieser Situation ist Isolierung
wichtiger als eine engmaschig kontrollierte Arbeitsleistung, und
was ist das Ergebnis? Jeder gibt sein Bestes unter teilweise
schwierigen Bedingungen. Vertrauen zahlt sich aus, vielleicht
ist auch dies eine Erkenntnis in der Krise und gibt Hoffnung für
ein besseres Miteinander auf Augenhöhe. Im Fazit des Jahres 2020
stehen für das Münzkabinett über 3.000 in hoher Qualität online
publizierte Münzen (das sind wenigstens 3.000 Stunden
Arbeitszeit), eine Zahl über dem üblichen Jahresdurchschnitt.
Keine Anfrage blieb unbeantwortet. Bei den meisten
Wissenschaftlern ist die digitale Schublade mit fast fertigen
Manuskripten deutlich leerer geworden. Ich rechne mit einem
Rekord an Publikationen für die Jahre 2020/21. Dies wird auch
für das Münzkabinett gelten. In eingeschränkter Weise blieb das
Münzkabinett für drängende Aufgaben zugänglich, so dass etwa
Marguerite Spoerri-Butcher ihr Forschungsstipendium der Stiftung
Preußischer Kulturbesitz zu den provinzialrömischen Münzen bei
uns bis Ende November vollenden konnte. Ebenso gingen die
eigenen Drittmittelprojekte weiter. Das ging nur, weil die
Mannschaft sinnvoll reduziert war und alle sich penibel an die
AHA-Regeln (Abstand halten, Hygiene beachten, Alltagsmasken)
hielten. Dieses verantwortungsvolle Handeln gilt für die
gesamten Staatlichen Museen. Zwar sind einige Mitarbeiter an
Corona erkrankt, aber die jeweils von außen hereingetragene
Krankheit fand in den Museen keine Weiterverbreitung.
Seit März haben wir neue Techniken zur
Durchführung von digitalen Videoveranstaltungen erlernt (Abb.
1), dazu musste die Ausstattung angepasst werden, was
teilweise in privater Initiative erfolgte. Alle Besprechungen
und Tagungen sind in den digitalen Raum verlagert, und es gibt
mittlerweile eher mehr als weniger Besprechungen und Workshops.

Wir können uns aber nicht daran gewöhnen,
dass es keine Besucher und Begegnungen bei Veranstaltungen mehr
gibt. Jeder von uns vermisst die sozialen Kontakte. Das wird mit
jedem Tag deutlicher. Seit dem Sommer haben wir einige
Video-Veranstaltungen mit der Numismatischen Gesellschaft
durchgeführt. Viele Mitglieder konnten sich mit dem virtuellen
Format bisher nicht anfreunden. Dafür erreichen wir solche
Mitglieder, die aufgrund des entfernten Wohnortes sonst nur
selten teilnehmen können. Die Teilnehmerzahlen sind höher. Es
gab sogar einen Antrag auf Neumitgliedschaft unter Hinweis auf
das neue digitale Angebot. Wir hoffen trotzdem, bald wieder zu
den elf Vortragsveranstaltungen an jedem vierten Donnerstag im
Monat im Studiensaal des Münzkabinetts zurückkehren zu können.
Bis dahin müssen wir uns mit digitalen Formaten behelfen. Bei
geeigneten Themen werden wir zukünftig darüber hinaus an dem
digitalen Videoformat festhalten, das sich sicher noch weiter
entwickeln lässt.
Die Pandemie ist nicht vorbei, noch wissen
wir nicht, was daraus wird, wir sind aber dankbar für die Arbeit
im Münzkabinett und das Team, das sich in der Krise bislang
glänzend bewährt hat.
Das Münzkabinett beteiligte sich an dem
Reformprozess, der sich ab Juni an die Evaluierung der Stiftung
Preußischer Kulturbesitz durch den Wissenschaftsrat anschloss.
Es ist an der Initiative NFDI4objects beteiligt, die im Oktober
ihren Antrag einreichte und auch in der Begutachtungsphase
weiterhin intensiv zusammenarbeitete. Im September begann das
EU-Projekt CHANGE, in dessen Rahmen 12.000 vorkaiserzeitliche
kleinasiatische Münzen erfasst werden. Ein viermonatiges Projekt
im Zuge eines BMBF-Projektes diente zur Erfassung keltischer
Münzen.
Zehn Jahre lang war Valentina Schröder das
Gesicht des Münzkabinetts (Abb. 2), die Person, auf die
unsere Besucher als erste trafen, nachdem sie von ihr in den
Studiensaal des Münzkabinetts eingelassen worden waren. Der
Studiensaal ist ein großer heller Raum mit langem Arbeitstisch,
der auch einen Teil unserer Bibliothek enthält. Es gibt drei
Kategorien von Besuchern des Münzkabinetts: Besucher von
Veranstaltungen, angemeldete Besucher für die Nutzung der
Bibliothek und von Beständen und die unangemeldeten Besucher.
Für die ersten beiden Gruppen lässt sich manches vorbereiten,
etwa bestellte Bücher heraussuchen oder Sicherheitsaufnahmen von
gewünschten Münzladen anfertigen. Die angemeldeten Besucher sind
oft Personen, die mehrmals kommen und die Arbeitsbedingungen
kennen. Viele von ihnen sind ausländische Wissenschaftler,
häufig ohne Deutschkenntnisse, die dankbar für die
Fremdsprachenkenntnisse von Valentina Schröder waren. Die
unangemeldeten Besucher erfordern gelegentlich diplomatisches
Geschick, etwa dann, wenn diese Zugang in Sicherheitsbereiche
erbitten oder ihnen erklärt werden muss, dass für
Materialvorlagen oder Münzbestimmungen Voranmeldungen wichtig
sind. Denn dafür ist auch die Anwesenheit des zuständigen
Kurators nötig.

Foto: Münzkabinett, Staatliche Museen zu Berlin, Achim Kleuker (2017)
Valentina Schröder ließ sich von 1969–1972
zur Finanzkauffrau an der Fachschule für Finanzwirtschaft in
Chişinău (Moldawien, UdSSR) ausbilden. Von 1974–1979 studierte
sie an der dortigen Staatlichen Universität Geschichte und war
anschließend von 1979–1988 wissenschaftliche Angestellte am
Pädagogischen Institut in Tiraspol. Im Jahr 1985 heiratete sie
Ralf Schröder, mit dem sie 1989 nach Berlin umzog. Seit 1989 war
sie Museumsangestellte bei den Staatlichen Museen.
Valentina Schröder hat neben der
Besucherbetreuung in der Bibliothek des Münzkabinetts
mitgearbeitet und dort u.a. die Auktionskataloge verzeichnet und
aufgestellt. Sie hat die Besucher und wissenschaftlichen
Mitarbeiter in ihren Anliegen unterstützt. Nicht nur in ihren
über 30 Dienstjahren bei den Staatlichen Museen zu Berlin hat
die Museumsamtsmeisterin Valentina Schröder tiefgreifende
Wechsel erlebt, die immer wieder eine Neuorientierung notwendig
machten. Waren der Umzug aus Moldawien (seit 1991 Republik
Moldau) nach Deutschland und der Mauerfall sicherlich die
einschneidenden Erfahrungen, so hat sich auch das Münzkabinett
in den letzten zehn Jahren gewandelt. Dass das Münzkabinett für
seine gute Infrastruktur und freundliche Atmosphäre gelobt wird,
ist nicht zuletzt ihr Verdienst.
Seit 1. Oktober 2020 ist Natalie Osowski
als Bibliotheksmitarbeiterin am Münzkabinett angestellt.
Mitarbeiter und Personalia
Prof. Dr. Bernhard Weisser, Museumsdirektor
(Münzen der Antike bis 3. Jh. n. Chr.; Gesamtleitung IKMK,
Corpus Nummorum). – Dr. Karsten Dahmen, Vertreter des Direktors
(Münzen der Spätantike und des Frühmittelalters, Byzanz,
Islam/Orient, ausländische Medaillen der Neuzeit; Datenredaktion
IKMK,
NUMiD,
NDP). –
Christian Stoess M.A. (Münzen des Mittelalters, der Neuzeit und
Moderne, von Europa und Übersee; Fotodokumentation). – Dr.
Johannes Eberhardt (Münzen und Medaillen der Neuzeit und Moderne
/ deutschsprachiger Raum; Geldscheine und Wertpapiere;
historisches Stempelarchiv der Berliner Münzstätte; Bibliothek)
Museumsassistent i. F.: Marjanko Pilekić
M.A. (ab 1.2.2020, Sonderurlaub von September bis Dezember für
Forschungsprojekt zur keltischen Münzprägung)
Restaurator: Dipl.-Restaurator (FH) Jens
Dornheim
Fotograf: Johannes Kramer (Jan.–Aug. 8%,
Sept.–Dez. 10%)
Sekretärin: Viola Gürke
Studiensaalaufsicht, Benutzer- und
Bibliotheksbetreuung: Valentina Schröder (bis 29.2.2020);
Natalie Osowski (ab 1.10.2020)
Projekt: Corpus Nummorum Thracorum –
Klassifizierung der Münztypen und semantische Vernetzung über
nomisma.org (Förderer: Deutsche Forschungsgemeinschaft, ab
2017): Dr. Angela Berthold (75%), Paula Michalski (stud.
Hilfskraft, ab 1.2.2020–31.5.20), Desiree Brunsch (stud.
Hilfskraft, ab 31.1.2020)
Projekt: CHANGE. The
development of the monetary economy of ancient Anatolia, c.
630–30 BC (Förderer: EU): Stefanie Baars M.A. (65%, seit
1.11.2020), Jan Peuckert M.Ed. (stud. Hilfskraft, seit
1.9.2020), Paula Michalski B.A. (stud. Hilfskraft, seit
1.11.2020)
Projekt: Kipper- und Wipper
(Förderer: Förderkreis des Münzkabinetts): Paul Höffgen (stud.
Hilfskraft, ab 7.9.2020)
Projekt: Corpus Nummorum Online – die
antiken griechischen Münzen von Moesia inferior, Mysien und der
Troas (Förderer BMBF): Andrea Gorys M.A. (externe
Mitarbeiterin, 50%)
Projekt: Netzwerk universitärer
Münzsammlungen in Deutschland = NUMiD (Förderer: BMBF): Dr.
Katharina Martin (externe Mitarbeiterin, 30%)
Mitarbeiter im Ehrenamt: Dipl.-Phil. Elke
Bannicke, Prof. Dr. Jannis Hourmouziadis, Prof. Dr. Bernd Kluge,
Horst Kosanke, Jürgen Morgenstern und Renate Vogel
Gemeinsam mit der Numismatischen
Gesellschaft zu Berlin und der Erivan und Helga Haub-Stiftung
trug das Münzkabinett dazu bei, (Nachwuchs-)Wissenschaftlern
Arbeiten an den Beständen zu ermöglichen: Dr. Alaa Aldin
al-Chomari, Stefanie Baars M.A., Paul Höffgen, Oksana Tokmina
und Dr. Sonja Ziesmann
Praktika (studienbegleitend): Elisa Kraft
und Antonia Schürgens
B. Weisser ist stellvertretender
Vorsitzender der Numismatischen Kommission der Länder. Er ist
Schatzmeister im Internationalen Numismatischen Rat und wurde
als numismatischer Preisrichter in die Jury der Wettbewerbe zur
Gestaltung der deutschen Gedenkmünzen berufen. Er ist im Beirat
der Deutschen Gesellschaft für Medaillenkunst und im Gremium zur
Verleihung des J. Sanford-Saltus Award. Er ist Mitglied im
wissenschaftlichen Beirat für das American Journal of
Numismatics. Gemeinsam mit K. Dahmen ist er im
wissenschaftlichen Beirat der Zeitschriften
Notae Numismaticae - Zapiski Numizmatyczne,
Krakau, und der Online Zeitschrift zur Antiken Numismatik
(OZeAN), Münster.
K. Dahmen leitet den Freundeskreis Antike
Münzen (FAM). Er ist Preisrichter für die ›Coin of the Year‹ von
Krause Publications. Er gehört der internationalen Arbeitsgruppe
zur Schaffung und Vereinheitlichung numismatischer Normdaten (www.nomisma.org)
an. Er ist Ombudsmann für gute wissenschaftliche Praxis für die
Stiftung Preußischer Kulturbesitz.
Ch. Stoess ist Präsident der Gesellschaft
für Internationale Geldgeschichte und Schatzmeister der
Numismatischen Kommission der Länder. Er ist wissenschaftlicher
Beirat der Numismatic Association of Australia.
J. Eberhardt ist Schriftführer der
Deutschen Gesellschaft für Medaillenkunst und Sprecher des
Berliner Medailleurkreises. Er wurde als numismatischer
Preisrichter in die Jury der Wettbewerbe zur Gestaltung der
deutschen Gedenkmünzen berufen. Er ist Mitglied im
wissenschaftlichen Beirat der Publikationsreihe Rei nummariae
scriptores, Triest.
J. Eberhardt, K. Dahmen und B. Weisser
gehören dem Vorstand der Numismatischen Gesellschaft zu Berlin
an, dem Förderverein des Münzkabinetts.
Erwerbungen
Insgesamt belief sich der Sammlungszuwachs
auf 206 Objekte:
Münzen: 3
Marken: 143
Medaillen und Modelle: 60
Von den insgesamt 31 Erwerbungsvorgängen
waren 17 Ankäufe, meist von zeitgenössischen Kunstmedaillen, und
14 Schenkungen. Ein Ankauf konnte mit Mitteln der Ernst von
Siemens Kunststiftung finanziert werden (Brakteat Acc.
2020/153). Für den Bereich Antike gab es keine Zuwächse, für das
Mittelalter konnte vorgenannter Brakteat erworben werden sowie
zwei Münzen der Neuzeit. Marken und Zeichen sind mit 143 Stücken
vertreten. Medaillen und Modelle machen 60 Objekte aus.
Der Großteil der Medaillenerwerbungen
betraf Direktankäufe von zeitgenössischen deutschen
Medailleuren, davon wurden 17 Arbeiten mit Haushaltsmitteln
bezahlt.
Im Berichtsjahr konnte der zweite Teil der
2019 begonnenen Schenkung von Ingeborg Lewandowski (vgl. Acc.
2019/35–187) in den Bestand überführt werden: Insgesamt 143
englische bzw. britische Marken (Token) aus der Sammlung ihres
2006 verstorbenen Mannes Helmut Lewandowski (Abb. 4). Als
weitere Sammlungserwerbung ist die vom Förderverein des
Münzkabinetts, der Numismatischen Gesellschaft zu Berlin,
angekaufte Sammlung Wissing mit Werken des Bühnenbildners und
Medailleurs Horst Sagert (1934–2014) zu nennen (Abb. 9).
Diese 24 Stücke sind dem Kabinett von der Gesellschaft geschenkt
worden. Ein Brakteat der Gertrud, Äbtissin von Eschwege, mit
Darstellung des Kaisers Friedrich I. Barbarossa (Abb. 3),
wurde mit Hilfe der Ernst von Siemens Kunststiftung erworben.
Weitere Geschenke für den Bestand des Münzkabinetts werden
Hanfried Bendig, Jürgen Dietrich, Marianne Dietz, Manfred
Olding, Dr. Manfred Posch (Abb. 5), Reinhard Seeck, Anna
Franziska Schwarzbach (Abb. 8) sowie der Staatlichen
Münze Berlin, dem Berufsverband des Deutschen Münzfachhandels
und der Deutschen Gesellschaft für Medaillenkunst verdankt.


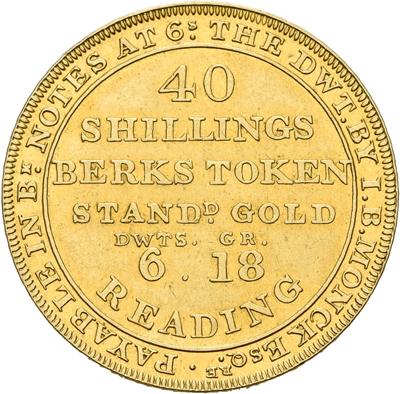



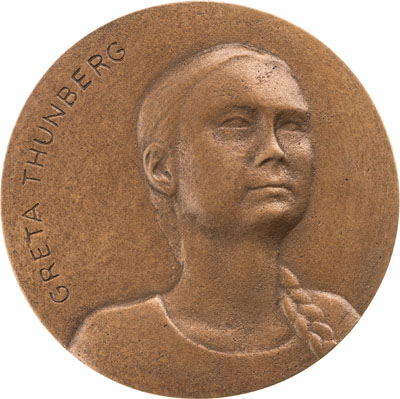
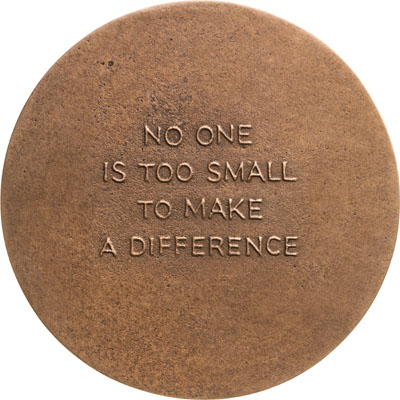




Publikationen
Monografie:
B. Weisser (Hrsg.), Münzkabinett.
Menschen Münzen Medaillen, Das Kabinett 17 (Regenstauf 2020).
Darin: Die Anfänge im kurfürstlichen Schloss. 16. Jahrhundert
bis 1830 (E. Bannicke, Ch. Stoess) – Im Königlichen Museum bis
zur Gründung des Münzkabinetts als eigenständiges Museum,
1830–1868 (B. Weisser) – Julius Friedländer als Direktor,
1868–1884 (B. Weisser) – Herausforderungen für Alfred von
Sallet, 1884–1897 (K. Dahmen) – Glanzzeit im
Kaiser-Friedrich-Museum. Julius Menadier und seine Zeit,
1898–1821 (B. Kluge) – Von Weimar zur Diktatur. Das Direktorat
Kurt Reglings (1921–1935) und Arthur Suhles kommissarische
Leitung bis 1945 (K. Dahmen) – Die Sammlung des Berliner
Münzkabinetts als Trophäengut. Die Jahre 1945–1958 (L. Schmidt)
– Zerstörung und Wiederaufbau. Arthur Suhle bis Heinz Fengler,
1945–1988 (B. Kluge, H. Simon, K. Dahmen und U. Kampmann) – Neue
Zeiten. Die Jahre 1988–2014 (B. Weisser) – Objektgeschichte und
Personengeschichte (B. Weisser) – Das Münzkabinett und seine
Hausherren (E. Bannicke) – Mitarbeiter im Münzkabinett (B.
Kluge, B. Weisser) – Wo kommen all die Münzen her? Die
Erwerbungen des Münzkabinetts und seine Beziehungen zum
Münzenhandel 1868 bis 1914 (Ch. Stoess) – Eine Sammlung – viele
Köpfe. Vorbesitzer- und Provenienzrecherche (K. Dahmen) –
Forschung und Wissenschaft (B. Weisser) – Das Münzkabinett und
die Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften. Eine
enge Partnerschaft (U. Peter) – Diebe und Verluste (B. Weisser)
– Förderer und Mäzene des Münzkabinetts seit 2004 (B. Weisser) –
Das Leitbild des Münzkabinetts (B. Weisser) –
Provenienzrecherche und ihre Hilfsmittel. Kartellen,
Erwerbungsbücher und -akten, Inventarbücher des Münzkabinetts ab
1649 (K. Dahmen) – Berliner Originale. Quellen zur Geschichte
des Münzkabinetts im Zentralarchiv der Staatlichen Museen zu
Berlin (B. Ebelt-Borchert, P. Winter) – Archivalische Quellen im
Geheimen Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz (J. Aberle)
(Abb. 10).
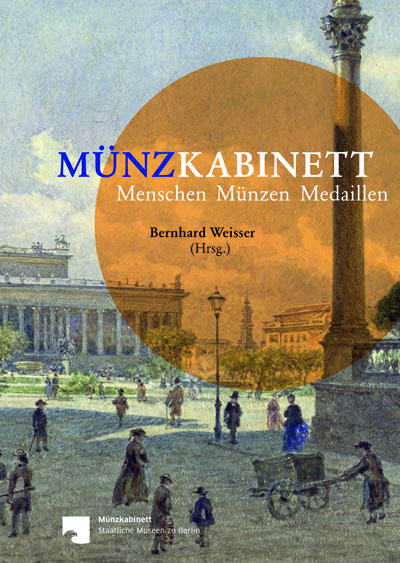
Weitere Aufsätze (in Auswahl):
Elke Bannicke
- Preußische Mariengeldmünzen zu VI und
XII Groschen sowie Dritteltaler von 1758/59 kamen nicht nur aus
der Dresdner sondern auch aus der Leipziger Münzstätte, in:
Beiträge zur brandenburgisch/preußischen Numismatik 28, 2020,
118–130: mit L. Tewes.
- Chronologie und Typologie der
sächsisch-polnischen Groschen aus Leipzig von 1753 bis 1756 und
deren preußische Repliken aus sächsischen sowie preußischen
Münzstätten von 1757 bis 1763, in: Beiträge zur
brandenburgisch/preußischen Numismatik 28, 2020, 102–117: mit L.
Tewes.
- Preußische ›Stiefelknechte‹ im
Zahlungsverkehr des Herzogtums Anhalt-Bernburg sowie die
Tätigkeit der Münzstätten Silberhütte 1793–1799 und Mägdesprung
1808–1813, in: Numismatisches Nachrichtenblatt 3, 2020, 91–97:
mit L. Tewes.
- Harzgold-Dukaten – geprägt 1706
bis 1766 aus Gold vom Fuße des Auerbergs bei Stolberg, in:
Numismatisches Nachrichtenblatt 9, 2020, 349–352: mit L. Tewes.
-
Silberdukaten von 1710 und 1717 nach
Leipziger Fuß aus der Münze zu Stolberg/Harz, in: Numismatisches
Nachrichtenblatt 10, 2020, 383–388: mit L. Tewes.
Johannes Eberhardt
- Popkultur aus Elektron? Musikmünzen aus
Syrakus, in: F. Haymann – S. Kötz – W. Müseler (Hrsg.), Runde
Geschichte: Europa in 99 Münz-Episoden (Mainz 2020) 55–57.
- Die ›Freiheit‹ des
Stempelschneiders – Hybride Imitation andalusischer Münzen, in:
F. Haymann – S. Kötz – W. Müseler (Hrsg.), Runde Geschichte:
Europa in 99 Münz-Episoden (Mainz 2020) 144–146.
- Tiermedaillen für Menschen. Zur
Sonderausstellung »Bronzen wie Tiere« zum Werk von Heide
Dobberkau, in: Numismatisches Nachrichtenblatt 69, 2020,
235–240.
-
Kommet, Ihr Hirten… Silberne
Weihnachtslieder für alle Sinne, in: Numismatisches
Nachrichtenblatt 69, 2020, 465–467.
Christian Stoess
-
A multi-technical study of silver denars from
medieval Poland for improved understanding of their
archaeological context and provenance, in: Archaeometry 2020,
1–18: mit M. Hrnjić, S. Röhrs, A. Denker, B. Weisser, M. Matosz
und J. M. del Hoyo-Meléndez.
- Goldmünzen der 2. Hälfte des 16.
Jahrhunderts (Schlussmünze 1567) aus einer archäologischen
Grabung in der Großen Oderstraße von Frankfurt (Oder), in:
Geldgeschichtliche Nachrichten 55, 2020, 403–405: mit M.
Antkowiak und K.-U. Uschmann.
-
Alexander von Humboldt und seine Münzen
und Medaillen, in: Geldgeschichtliche Nachrichten 55, 2020,
394–402: mit K. Lepekhina.
Bernhard Weisser
-
Die
Fundmünzen von Priene im Kontext, in: W. Raeck – A. Filges und
H. Mert, Priene von der Spätklassik bis zum Mittelalter.
Ergebnisse und Perspektiven der Forschungen seit 1998 (Bonn
2020) 251–288, Taf. 61–69, Farbtafel 18: mit J. Eberhardt.
-
Nationale
Forschungsdateninfrastruktur, in: MuenzenRevue 4/2020, 22–24.
-
Briefe aus
Berlin, Numismatisch-museologische Betrachtungen, in:
MuenzenRevue 52, 2020 (Briefe Nr. 25–35: 25. Peter Robert
Franke; 26. Wie eine Ausstellung entsteht; 27. Ein neuer
Förderkreis für das Münzkabinett; 28. Valentina Schröder; 29.
Corona-Pandemie; 30. Patenschaften; 31. Erwerbungen; 32. Das
erste Video-Münzsammlertreffen in Deutschland; 33.
Dienstjubiläum in stürmischer Zeit; 34. Das Bode-Museum; 35.
Warum der Pergamonaltar NICHT mit dem Thron Satans aus der
Johannes-Offenbarung gleichzusetzen ist: mit A. Gorys).
-
Das Münzkabinett, Staatliche Museen zu Berlin (Preußischer
Kulturbesitz), im Jahr 2019, in: OZeAN 2, 2020, 141–154.
-
Das Münzkabinett im Jahr 2016, in: Jahrbuch der Berliner
Museen. Ehemals Jahrbuch der Preußischen Kunstsammlungen 59,
2017 (2019) 30–35.
- Das Münzkabinett im Jahr 2017, in: Jahrbuch der Berliner Museen. Ehemals Jahrbuch der Preußischen Kunstsammlungen 60, 2018/19 (2020) 39–45.
Die Zeitschrift ›Geldgeschichtliche
Nachrichten‹ der Gesellschaft für Internationale Geldgeschichte
wird von Ch. Stoess herausgegeben.
Social Media
B. Weisser, K. Dahmen, J. Eberhardt und M.
Pilekić berichteten auf Twitter über die Arbeit im Münzkabinett.
Diese Form der Öffentlichkeitsarbeit erfreut sich wachsender
Beliebtheit. Unterstützt wurden sie dabei mit Inhalten und
Bildern von Mitarbeitern im Münzkabinett.
Sammlungen, Forschung, Lehre und digitale Transformation
a) Sammlungen
Fortgesetzt wurden Arbeiten an den Münzen
aus Mysien, der Troas und aus Moesia Inferior, ein
Viermonatsprogramm diente der Veröffentlichung von keltischen
Münzen. Im September wurde mit der Erfassung der
vorkaiserzeitlichen Münzen Kleinasiens begonnen. Fortgesetzt
wurde die Erfassung der deutschen Münzen von 900–1140 (Herzogtum
Sachsen) und brandenburgisch-preußische Medaillen. Begonnen
wurde auch mit der Dokumentation der sog. Kipper und Wipper
sowie der Sammlung ›Ius in nummis‹ von Thomas Würtenberger.
Alle Wissenschaftler dokumentierten
Objekte im Interaktiven Katalog des Münzkabinetts (IKMK). Die
Provenienzforschung betraf viele Einzelrecherchen. Ansonsten
wurde die Arbeit an der Sammlung durch Materialvorlagen im
Studiensaal, Anfragen, Leihersuchen und Fotowünsche bestimmt,
wobei jeweils parallel die Eingabe dieser Objekte in den IKMK
erfolgte. Darüberhinausgehende Arbeiten waren eigene
Wissenschaftsvorhaben gewidmet (s. dort).
Die Neuaufnahmen von Ladensicherungsbildern
erhöhen die Gesamtanzahl an Ladensicherungsbildern auf 7.110
(2019: 6.857). Johannes Kramer fertigte qualitätvolle Aufnahmen
von ca. 180 Objekten an und nahm Ausstellungs- und
Eventdokumentationen vor. Die Zahl der fotografierten
Einzelobjekte mit dem System Quickpx ist von 60.500 im
Vorjahr auf 84.537 Stück gestiegen: (1.397 Laden, 723 Antike und
674 Mittelalter/Neuzeit). Damit wurden im Jahr 2020 24.000
Objekte (Vorjahr: 15.500 Objekte) neu mit dem System Quickpx
erfasst (Abb. 11). Diese ist der mit Abstand
höchste Wert seit Anschaffung des Fotosystems. Vor allem durch
spezielle Forschungsvorhaben im Rahmen von Drittmittelprojekten
wurde diese hohe Zahl erreicht. Das System Quickpx wurde
zur Aufnahme von Münzen und Medaillen auch an die
Skulpturensammlung und die Kulturverwaltung des Bundes
entliehen. Mit der Implementierung der Kerndaten in die
Aufnahmen, einer Entwicklung Winfried Danners in Zusammenarbeit
mit dem Münzkabinett, hat sich das System Quickpx als
führendes System bei der fotografischen Dokumentation von Münzen
und Medaillen durchgesetzt. In einer Fotokampagne der Firma
Lübke & Wiedemann wurden 1.731 Objekte aufgenommen, für die sich
das hauseigene Fotosystem Quickpx nicht eignet. Somit
sind insgesamt 25.948 Objekte im Jahr 2020 fotografisch erfasst
worden (Ch. Stoess).
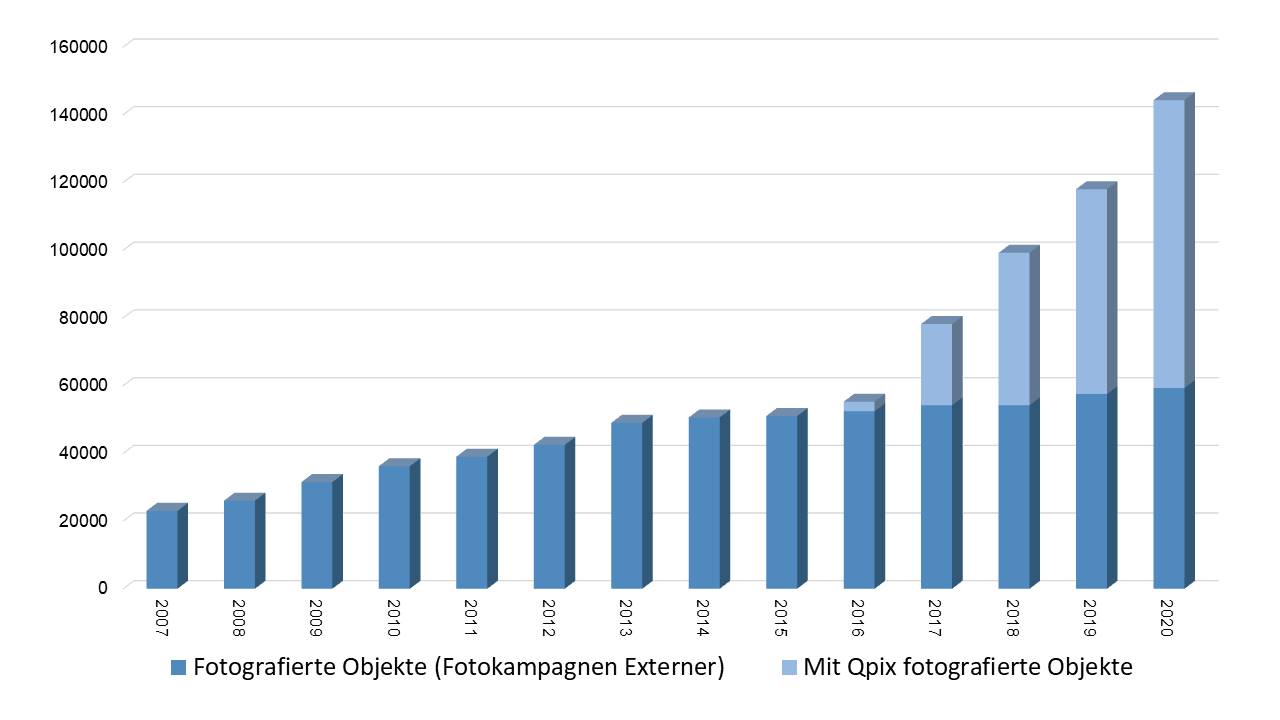
b) Bibliothek und Studiensaal
Der Bestand ist um 196 Monographien und 87
Bände Periodika gewachsen, davon kamen 91 als Tausch- und
Belegexemplare oder als Schenkung in das Münzkabinett. Die
Retrokonversion der Bibliotheksbestände Im OPAC der
SMB-Bibliotheken umfasst nun 9.511 Titel. Die Bibliothekare von
der Kunstbibliothek, Daniel Schatz und Elisabeth Scheele, haben
die Signierung der Bestände fortgesetzt, die im Zuge dieser
Arbeiten auch in neuer Ordnung aufgestellt werden (J.
Eberhardt). 621 Besucher wurden im Studiensaal betreut. Dies
sind weniger als die Hälfte der Besucher von 2019 (1.272) (V.
Schröder, N. Osowski).
c) Restaurierung (J. Dornheim)
Schwerpunkte waren auch in diesem Jahr,
neben der präventiven Konservierung, die restauratorische und
konservatorische Betreuung des Sammlungsbestandes. In diesem
Rahmen wurden insgesamt 1.095 Objekte auf ihren Zustand hin
überprüft. Daraus leiteten sich an 681 Objekten
restauratorisch-konservatorische Maßnahmen ab. Dies betraf
insbesondere den Bestand an antiken Silber- und Bronzemünzen der
römischen Kaiserzeit (Lydien, 1. Jh. v. Chr. bis 3. Jh. n. Chr.)
sowie für Ausstellungen vorgesehene Objekte, hier vor allem
mittelalterliche Denare und Brakteaten. In diesem Zusammenhang
ist vor allem die rheinland-pfälzische Landesausstellung »Die
Kaiser und die Säulen ihrer Macht« in Mainz zu nennen. Aber auch
für Fotoaufträge wurden Objekte, z. B. Goldmünzen der römischen
Kaiserzeit, restauratorisch bearbeitet. Die erforderlichen
Arbeiten umfassten die Reinigung der Objekte sowie das Entfernen
von Korrosionsprodukten, mit sich – je nach Notwendigkeit –
daran anschließenden Konservierungsmaßnahmen. Aus dem
künstlerischen Nachlass des Bildhauers und Medailleurs Gerhard
Rommel (1934–2014) wurden insgesamt 67 auf Hartfaserplatten
verklebte Bronzemedaillen behutsam vom Untergrund gelöst und
anschließend einer Restaurierung unterzogen. Auch hier stand die
Korrosionsproblematik im Vordergrund. Des Weiteren wurden im
Sammlungstresor Metallschubladen gereinigt und insgesamt 840
Münzen auf neuen Tablaren ausgelegt.
Das sich im Bestand des Münzkabinetts
befindende kleine Ölgemälde von Suzette Henry (1763–1819,
Künstlerin und Tochter des Kupferstechers Daniel Chodowiecki)
mit dem Porträt ihres Ehemannes Jean Henry (1761–1831, Prediger
und Vorsteher der Königlichen Kunstkammern) konnte restauriert
werden (Abb. 12). Die erforderlichen Maßnahmen am Gemälde
(einschließlich Zierrahmen) wurden von Frau Dipl.-Restauratorin
M.A. Christiane von Pannwitz, Berlin, ausgeführt.
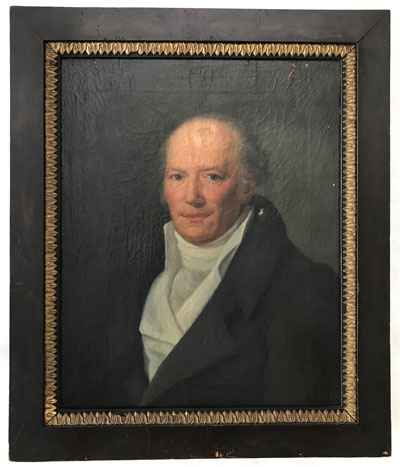
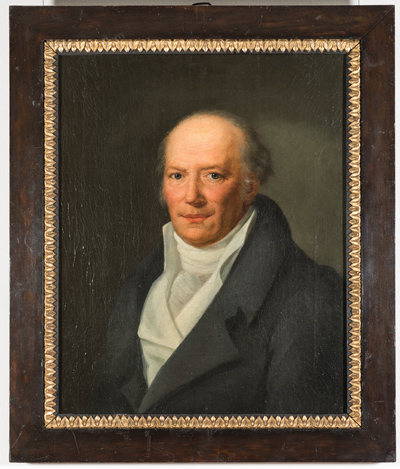
Für die Dauerausstellung im Museum Schloss
Lübben wurden zwei galvanoplastische Kopien hergestellt. Dabei
handelte es sich um Repliken von im 19. Jh. auf dem Gebiet des
heutigen Bundeslandes Brandenburg gefundenen, antiken römischen
Münzen (Aureus, 70 n. Chr., und Denar, 166 n. Chr.). Um das zwar
äußerst präzise und qualitätsvolle, aber leider auch zeit- und
materialaufwändige Verfahren der galvanoplastischen
Vervielfältigung zukünftig eventuell durch die innovative
3D-Druck-Technologie ablösen zu können, gab es in diesem Jahr
eine fortgesetzte Zusammenarbeit mit dem Zentrum für
digitale Kulturgüter in Museen (ZEDIKUM) und eine erste
Kontaktaufnahme mit der Technischen Universität Berlin. Die bei
den durchgeführten Versuchen erzielten Ergebnisse sind
vielversprechend, reichen hinsichtlich ihrer Qualität aber noch
nicht an eine Galvanoplastik heran. Die Zusammenarbeit mit den
genannten Institutionen soll fortgesetzt werden.
Gemeinsam mit Herrn Reinhard Uecker,
Berlin, wurden mecklenburgische Witten (Silbermünzen, 1410–1450)
bei der Bruker Nano GmbH mittels Röntgenfluoreszenzanalyse
(RFA) metallurgisch auf ihren Silbergehalt hin untersucht. Bis
auf eine Ausnahme deckten sich die gewonnenen Werte mit denen
der bisher an Witten vorgenommen Messungen und die Silbergehalte
konnten damit bestätigt werden.
Im Rahmen der Ausbildung von
wissenschaftlichem Nachwuchs am Münzkabinett wurde erstmals seit
langer Zeit wieder eine Studentin der Metallrestaurierung im
Rahmen ihres Pflichtpraktikums betreut (Abb. 13). Dafür
wurde ein zweiter Arbeitsplatz in der Restaurierungswerkstatt
eingerichtet. Die Studentin konnte während ihrer 22-wöchigen
Praktikumszeit einen umfassenden Einblick in die Arbeit des
Restaurators am Münzkabinett erlangen und ihre Kenntnisse und
Fertigkeiten auf dem Gebiet der Metallrestaurierung festigen und
vervollkommnen.

d) Forschung/Wissenschaft
Das Gemeinschaftsprojektes mit der
Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften »Corpus
Nummorum« (CN) wurde fortgesetzt. Weiterhin wird die
Datenbank
www.corpus-nummorum.eu im technischen und
inhaltlichen Ausbau seitens des Münzkabinetts mitbetreut (A.
Berthold, P. Michalski). Für die Regionen Troas und Moesia
Inferior wurden die Bilder und Kerndaten zur Verfügung gestellt.
Die Münzen verschiedener mysischer und troischer Münzstätten
wurden in den IKMK und in CN eingegeben (B. Weisser, A. Gorys).
Im September startete das Projekt ›CHANGE.
The development of the monetary economy of
ancient Anatolia, c. 630-30 BC‹. Es handelt sich um ein
von der Europäischen Union gefördertes Forschungsprojekt, das
die Erstellung eines digitalen Typenkatalogs der
vorkaiserzeitlichen Münzprägung Kleinasiens zum Ziel hat. Der
Zeitraum erstreckt sich vom Beginn der Münzprägung im späten 7.
Jh. v. Chr. bis zum Jahre 30 v. Chr., dem Beginn des römischen
Prinzipats. Es soll ein vollständiger Überblick über alle etwa
336 ausprägenden Münzstätten (Abb. 14) gegeben werden
sowie über die vier Großreiche, sechs Königreiche und etwa 50
unabhängige Herrscher, die in ca. 6 Jahrhunderten in der Region
regierten. Die Datenbank wird letztlich ca. 50.000 Objekte aus
fünf Sammlungen umfassen. Das Berliner Münzkabinett steuert
davon etwa 12.000 Objekteinträge bei, die als Linked Open Data
vorliegen werden (B. Weisser, S. Baars, P. Michalski, J.
Peuckert).

Maßgeblich mit Eigenmitteln ist das
Münzkabinett seit 2017 an NUMiD (www.numid-verbund.de)
beteiligt, der Erschließung universitärer Sammlungen in
Deutschland (Sprecher: Prof. Dr. Johannes Wienand,
Koordinatorin: Dr. Katharina Martin). Die Stammdaten werden in
Berlin gesammelt, ediert und verwaltet. Den Hauptarbeitsbereich
bildete die Erstellung neuer Konzepte, deren Anreicherung mit
Identifikatoren sowie in Abstimmung mit der Koordinatorin die
Zusammenarbeit mit den 42 bereits in NUMiD aktiven Sammlungen.
Der Stammdatenexport betrifft derzeit 33 Sammlungen. Am Ende des
Jahres 2020 waren über das Zentralportal des NUMiD-Verbundes
unter der Adresse
https://www.numid.online 26.826 in den verschiedenen
IKMKs veröffentlichte Objekte online (2019: 21.333). Das Projekt
wurde vom BMBF um ein Jahr bis Ende März 2021 verlängert (K.
Dahmen, B. Weisser).
Die Arbeit an Archivalien betraf die
Kabinettsgeschichte, die Korrespondenz von Arthur Löbbecke und
die Recherche zu Vorbesitzern und Veräußerern.
Als Forschungsstipendiatinnen der Stiftung
Preußischer Kulturbesitz arbeiteten H.-L. von Lenthe (Wien) und
M. Spoerri-Butcher (Oxford) am Münzkabinett.
e) Lehre
S. Baars, J. Eberhardt und B. Weisser
führten Lehrveranstaltungen an der Humboldt-Universität zu
Berlin durch. Die von Ch. Stoess angekündigten
Lehrveranstaltungen, die die Sammlungsbenutzung voraussetzten,
mussten aufgrund der Pandemie ausfallen. S. Baars, K. Dahmen, J.
Eberhardt und B. Weisser veranstalteten zusätzlich Führungen und
Handübungen mit Studierenden im Rahmen von anderen
Universitätsveranstaltungen.
Paul Höffgen verfasste an der
Humboldt-Universität eine Bachelorarbeit, die im Zusammenhang
mit der Neuerwerbung englischer Token stand: »‘To
facilitate trade change being scarce‘. – Die Rolle der
britischen Silber-Token von 1811–1812 im alltäglichen
Zahlungsverkehr. Eine Untersuchung anhand der Token-Sammlung
Lewandowski im Münzkabinett der Staatlichen Museen zu Berlin«.
Derzeit werden drei numismatische Dissertationen am Münzkabinett
mitbetreut.
f) Digitale Transformation
Ende 2020 waren 39.841 Objekte des
Münzkabinetts im World Wide Web (ikmk.smb.museum)
publiziert. Der Zuwachs betrug im Jahre 2020 3.001 Objekte
(2019: 2.788). Dies war, wie in den letzten dreizehn Jahren, nur
durch den enthusiastischen Einsatz aller Beteiligten zu
erreichen. Die materialbezogene wissenschaftliche Dokumentation
erfolgt auch weiterhin weitgehend durch die Einwerbung von
Drittmitteln.
Das Erfassungssystem mk_edit wurde um die
neuen Kategorien Herstellungseigenschaften und sekundäre
Merkmale ergänzt. Ein neues Feature (Projekt Heidelberg) bietet
nun die Möglichkeit, Graffiti auf Münzen mittels
Beschreibungsfeldern und normierten Graffitikürzeln umfänglich
zu dokumentieren.
Der Bestand an Normdaten wurde weiter
erhöht. Sie werden auch vom KENOM-Verbund genutzt.
Personeneinträge: 11.062 (2019: 10.035), darunter u. a.
Vorbesitzer 1.424 (2019: 1.348), Münzherren: 2.734 (2019:
2.418), Dargestellte: 3.360 (2019: 3.043). Dazu kommen z.B.
Geographika (Münzstätten, Ausgabeorte, Fundorte): 3.307 (2019:
3.023). Diese mit weiteren Linked Open Data-Konzepten und
Beschreibungen angereicherten Normdaten werden in einem eigenen
Normdatenportal präsentiert:
https://ikmk.smb.museum/ndp. Über VoIDRDF erfolgt der
Datentransfer zu anderen numismatischen Spezialportalen (hier
der American Numismatic Society). Die Datenexporte können nun
direkt vom Münzkabinett in diese Portale ausgelöst werden. Dies
betrifft nicht nur den IKMK des Berliner Münzkabinetts, sondern
auch alle Sammlungen des IKMK-Verbundes. Hier erfüllt das
Münzkabinett eine wichtige institutionsübergreifende Funktion
für die deutsche und internationale Numismatik (K. Dahmen).
Ausstellungen und Veranstaltungen
Im Bode-Museum wurden als eigene
Ausstellungen »Bronzen wie Tiere. Heide Dobberkau und ihre
Tierwelten« (J. Eberhardt und W. Steguweit) und »Von Eva bis
Greta. Frauen auf Münzen und Medaillen« (J. Eberhardt) gezeigt.
Während die letztere Ausstellung seit November auf ihre Besucher
wartet und 2020 aufgrund der Corona-Maßnahmen geschlossen blieb,
war die Dobberkau-Ausstellung wenigstens einige Monate geöffnet
und erfreute sich großer Beliebtheit. Es entstand in
Zusammenarbeit mit dem ZEDIKUM und museum 4.0 ein digitales
Führungsblatt:
https://xplore.museum4punkt0.de/mk-pwa (Abb.
15) und während der ersten Schließungsphase ein Film zur
Ausstellung:
https://www.smb.museum/museen-einrichtungen/muenzkabinett/ueber-uns/filme.
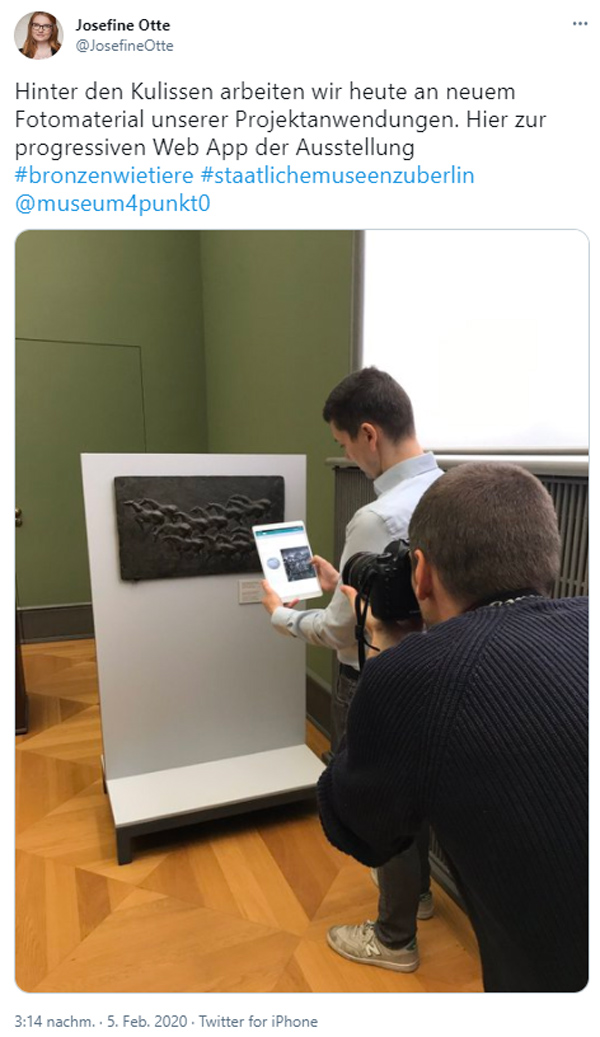
Abb. 15: Erstmals wurde eine
Ausstellung durch ein digitales Führungsblatt begleitet,
das in Verbindung mit museum4punkt0 entstand. Foto:
Josefine Otte
Im Rahmen der Dobberkau-Ausstellung
organisierte J. Eberhardt erstmals einen zweitägigen
Medaillenworkshop (Abb. 16a–b), der von den
Bildhauerinnen und Medailleurinnen Marianne Dietz und Adelheid
Fuss geleitet wurde. Da die Ausstellung »Von Eva bis Greta« auch
nach Fertigstellung geschlossen bleiben musste, veröffentlicht
Ausstellungskurator J. Eberhardt seit November werktäglich ein
Exponat der Sonderausstellung über Twitter. Im Rahmen der
Ausstellungsvorbereitung und in Zusammenarbeit mit der Deutschen
Gesellschaft für Medaillenkunst führte J. Eberhardt einen
Nachwuchswettbewerb im Bereich der Medaillenkunst zu dem Thema
»Drei Grazien« durch, der am 8. Oktober juriert wurde. Die
prämierten Arbeiten und eine Auswahl der Beiträge wurden in die
Sonderausstellung aufgenommen.


In der Dauerausstellung im Bode-Museum
wurde vom Januar bis zum ersten Lockdown im März die Ausstellung
»Perlentausch – Wissen, Werte, Welten« des Ethnologischen
Museums in zwei Vitrinen präsentiert (C. Heroven, Ch. Stoess),
die später im Humboldt-Forum zu sehen sein wird. Das
Münzkabinett beteiligte sich an der neuen Dauerausstellung im
Bode-Museum, die ebenfalls noch nicht geöffnet werden konnte:
»Klartext. Zur Geschichte des Bode-Museums«.
Bedingt durch die Covid-19-Pandemie kam der
Leihverkehr – vor allem jener außerhalb der Staatlichen Museen
zu Berlin – dieses Jahr nahezu zum Erliegen. So gab es lediglich
drei Leihvorgänge mit insgesamt 38 Leihgaben. Mit 30 Objekten
war die Entleihe an das Landesmuseum Mainz für die Ausstellung
»Die Kaiser und die Säulen ihrer Macht. Von Karl dem Großen bis
Friedrich Barbarossa« die umfangreichste, aber auch die einzige
außerhalb von Berlin zu betreuende. Für den Katalog B.
Schneidmüller (Hrsg.), Die Kaiser und die Säulen ihrer Macht.
Von Karl dem Großen bis Friedrich Barbarossa (Mainz 2020)
verfassten Ch. Stoess und P. Höffgen 30 Katalogbeiträge.

Ch. Stoess führte am 12. September die
Jahresversammlung der Gesellschaft für Internationale
Geldgeschichte in Frankfurt/M. durch. Die Treffen der
Arbeitsgruppe »Experimentelle Numismatik« fielen aus.
Im Jahr 2020 sind zahlreiche Vorträge
ausgefallen oder wurden in den digitalen Raum verlagert.
Vorträge wurden gehalten: von K. Dahmen in Berlin (online) und
Braunschweig, von J. Eberhardt in Berlin (online) und Erfurt
(online), von M. Pilekić in Berlin (online), von Ch. Stoess in Berlin und
Mainz und von B. Weisser in Berlin, Braunschweig und Warschau.
Digital wurden zwei Veranstaltungen in Verbindung mit der
American Numismatic Society durchgeführt: zum Beginn der
Münzprägung in Milet und zur Verleihung des J.-Sanford
Saltus-Award an die Berliner Bildhauerin Anna Franziska
Schwarzbach. Der Videovortrag zu Milet, der bei der
Numismatischen Gesellschaft zu Berlin durchgeführt wurde, war
zugleich der erste Vortrag in diesem digitalen Format einer
numismatischen Gesellschaft in Deutschland überhaupt.
Hervorzuheben sind auch die Video-Veranstaltungen anlässlich der
Fertigstellung der Ausstellung »Von Eva bis Greta. Frauen auf
Münzen und Medaillen« im November und die Präsentation der neuen
Kabinettspublikation von fast allen Mitarbeitern im Dezember
(Abb. 1).

Der Förderkreis des Münzkabinetts
Am 22. November 2019 hat sich eine Gruppe
von Freunden des Münzkabinetts und der Numismatik in Berlin
zusammengefunden. Sie hat einen Förderkreis für das Münzkabinett
gegründet. Damit erfüllte sich ein im Münzkabinett lang gehegter
Wunsch. Zum Sprecher wurde Carl-Ludwig Thiele gewählt. In der
Mitgliederversammlung der Numismatischen Gesellschaft zu Berlin,
gegr. 1843, die satzungsgemäß der Förderverein des Münzkabinetts
ist, wurde der Förderkreis am 23. Januar einstimmig als neuer
Arbeitskreis innerhalb der Numismatischen Gesellschaft
aufgenommen. Der Förderkreis blickt auf ein sehr erfolgreiches
erstes Jahr zurück. Insgesamt wurden 102.500 Euro für acht
verschiedene Projekte und Erwerbungen zur Verfügung gestellt
(z.B. Abb. 9). Den Hauptposten bildet die Finanzierung einer
dreijährigen studentischen Hilfswissenschaftlerstelle zur
Kern-Erfassung der Kipper- und Wipperprägungen. Es folgen die
Erwerbung der Sammlung Wissing und Arbeiten an der neu
erworbenen Sammlung »Ius in nummis« von Thomas Würtenberger. Die
weiteren Positionen betrafen kleinere Arbeiten im Zusammenhang
mit dem IKMK und ein Video anlässlich der Verleihung des J.
Sanford Saltus-Award an Anna Franziska Schwarzbach.