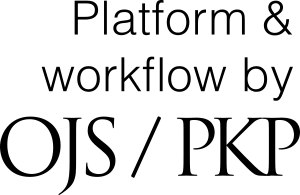![]()
Unsere Zeitschrift ist Teil der Webseite Mittelalter Digital, die möglichst viele Zugänge zur Epoche des Mittelalters zusammenführen möchte.
Beitragseinreichung
Checkliste für Beitragseinreichungen
Als Teil des Einreichungsverfahren werden die Autor/innen gebeten, anhand der Checkliste für Beiträge die Übereinstimmung ihres Beitrags Punkt für Punkt mit den angegebenen Vorgaben abzugleichen. Beiträge können an Autor/innen, die die Richtlinien nicht befolgen, zurückgegeben werden.- Der Beitrag ist bisher unveröffentlicht und wurde auch keiner anderen Zeitschrift vorgelegt (andernfalls ist eine Erklärung in "Kommentare für die Redaktion" beigefügt).
- Die Datei liegt im Format Microsoft Word oder RTF vor.
- Soweit möglich, wurden den Literaturangaben URLs inkl. Abrufdatum beigefügt.
- Alle Illustrationen, Grafiken und Tabellen sind an geeigneter Stelle im Text inkl. Bildnachweis eingefügt sowie separat als Datei mitgeschickt.
- Der Text folgt den stilistischen und bibliografischen Vorgaben in Richtlinien für Autor/innen.
Richtlinien für Autor/innen
Grundsätzliches
- Die Autoren und Autorinnen sind Inhaber / Inhaberinnen aller Rechte an von ihnen eingereichten und veröffentlichten Artikeln (Inhalte und Materialien).
- Die Autoren und Autorinnen verbürgen sich für die von ihnen vorgenommenen Quellenangaben und die Einhaltung der DFG-Standards für gute wissenschaftliche Praxis.
- Jegliche Urheberrechtsverletzungen gehen zu Lasten der Autoren und Autorinnen.
- Die eingereichten Texte werden von jeweils zwei Redaktionsmitgliedern unabhängig voneinander betreut. Die Korrespondenz erfolgt jeweils mit dem „hauptverantwortlichen“ Redaktionsmitglied.
- Falls notwendig, geht der Text kommentiert und mit Änderungsvorschlägen an den/die Autoren und Autorinnen zurück.
- Die Einsendung des Textes erfolgt als Word-Dokument (.docx) oder einem ähnlich einschlägigen Dateiformat, das die Möglichkeit zur Bearbeitung bietet, an folgende E-Mail-Adresse: skriptorium@mittelalter.digital
- Zu jeder Einsendung bitten wir die Autoren und Autorinnen um ein Portraitbild und einen Kurz-CV.
- Mit der Einreichung des Manuskripts erklären sich die Autoren und Autorinnen zur Veröffentlichung des Artikels im Open Access bereit und stimmen der Veröffentlichung ihres Beitrags unter der Lizenz CC BY zu.
Zitation
Einzelne Zitate und Belege werden als Intextzitation angegeben, und zwar in runden Klammern nach der entsprechenden Textpassage. Längere bzw. mehrere Belege und der Forschungsdiskurs sowie ergänzende Anmerkungen zum Fließtext werden in Fußnoten wiedergegeben. Für die Zitation werden Kurzzitationen verwendet; eine vollständige bibliographische Angabe hält das Literaturverzeichnis bereit:
Kurztitel: Autor/in (Nachname) Jahreszahl, ggf. mit Kleinbuchstaben alphabetisch spezifiziert, S. xx.
Beispiele:
Lore ipsum Beispieltext, der Spannendes anschaulich referiert (vgl. Müller 1977, S. 31-44).
Werner 1950a, S. 12-129.
Formalia
- Überschriften bitte auf maximal 2 Ebenen (Titel plus Kapitelüberschriften)
- Primärquellentext und Begrifflichkeiten in Latein, Mittelhochdeutsch, Altnordisch o.ä. bitte kursiv.
- Primärquellentexte in Fremdsprachen (außer englisch) und älteren Sprachformen wenn möglich mit neuhochdeutscher Übersetzung.
- Titel (etwa von Medien, Ausstellungen etc.) in französischen Anführungszeichen ›Beispiel‹ (ASCII: Alt + 0155 bzw. Alt + 0139).
Einträge im Literaturverzeichnis
- Im Literaturverzeichnis wird die verwendete Literatur vollständig erfasst. Die Kurzzitationen werden den einzelnen Einträgen vorangestellt, und zwar wie folgt:
Müller 1977: Torsten Müller, Beispielhaftes am Beispiel von Beispielen, Berlin 1977.
Ferner gilt:
- Bei zwei Autoren und Autorinnen: Trennen mit /
- Bei mehreren Autoren und Autorinnen (ab 3 Autoren und Autorinnen): Erstautor/in [u.a.]
- Bei mehreren Orten (ab 3 Orten): Erstort [u.a.]
- Bei keinem Ort: o.O
- Bei keinem Jahr: o.J
Primärtext
Handschrift:
Autor:in, Titel, Standort, Signatur, Ort und Datum, fol.
Große Heidelberger Liederhandschrift C (Codex Manesse), Universitätsbibliothek Heidelberg, Cod. Pal. germ. 848, Zürich, ca. 1300-1340.
Edition:
Titel. Untertitel. Titelzusatz, hrsg. v. Herausgeber/in (Vorname Nachname), Ort AuflageJahr (= Reihentitel Reihennummer).
Des Minnesangs Frühling. Bd. 1: Texte, hrsg. v. Hugo Moser / Helmut Tervooren, Stuttgart 381988.
Epitaphium ducis Friderici Austrie et Stirie, hrsg. v. Wilhelm Wattenbach, Hannover 1854 (= MGH SS 11).
Sekundärtext
Monographie:
Autor:in (Vorname Nachname), Titel. Untertitel (Anm: Titel, die selbst Zitate sind, werden nicht kursiviert, s. Bsp. 2). Titelzusatz, Ort AuflageJahr (= Reihentitel Reihennummer).
Georges Duby, Guillaume le Maréchal oder der beste aller Ritter. Aus dem Französischen von Reinhard Kaiser, Frankfurt a. M. 32017.
Thomas Bein, „Mit fremden Pegasusen pflügen“. Untersuchungen zu Authentizitätsproblemen in mittelhochdeutscher Lyrik und Lyrikphilologie, Berlin 1998 (= Philologische Studien und Quellen 150).
Sammelband:
Herausgeber/in (Vorname Nachname) (Hrsg.): Titel. Untertitel. Titelzusatz, Ort AuflageJahr (= Reihentitel Reihennr.).
Josef Fleckenstein (Hrsg.), Das ritterliche Turnier im Mittelalter. Beiträge zu einer vergleichenden Formen- und Verhaltensgeschichte des Rittertums, Göttingen 1985 (= Veröffentlichungen des Max-Planck-Instituts für Geschichte 80).
Aufsatz in Sammelband:
Autor/in (Vorname Nachname), Titel. Untertitel, in: Herausgeber/in (Vorname Nachname) (Hrsg.), Titel. Untertitel. Titelzusatz, Ort AuflageJahr (= Reihentitel Reihennr.), S. x-y.
Joachim Bumke, Tannhäusers ‘Hofzucht’, in: Ulrich Ernst / Bernhard Sowinski (Hrsg.), Architectura Poetica. FS für Johannes Rathofer zum 65. Geburtstag, Köln 1990 (= Kölner Germanistische Studien 30), S. 189-205.
Volker Mertens, Kaiser und Spielmann. Vortragsrollen in der höfischen Lyrik, in: Gert Kaiser / Jan-Dirk Müller (Hrsg.), Höfische Literatur und Hofgesellschaft. Höfische Lebensformen um 1200. Kolloquium am Zentrum für Interdisziplinäre Forschung der Universität Bielefeld (3. bis 5. November 1983), Düsseldorf 1986 (= Studia humaniora 6), S. 455-469.
Aufsatz in Zeitschrift:
Autor/in (Vorname Nachname): Titel. Untertitel, in: Zeitschrift (Zeitschriftenname ausgeschrieben) Jahrgang, Heftnr. (Jahr), S. x-y.
Fritz Peter Knapp, Literatur und Publikum im österreichischen Hochmittelalter, in: Jahrbuch für Landeskunde von Niederösterreich N.F. 42 (1976), S. 160-192.
Zitieren:
- Titel werden in französischen Anführungszeichen zitiert: ›Assassin’s Creed‹
- Textzitate in doppelten Anführungszeichen: „Er geht ins Kino“. (Direkte oder einführende Zitate werden ab 3 Zeilen als Zitatblock abgebildet)
Bildmaterial
Abbildungen in wissenschaftlichen Publikationen fallen in den meisten Fällen unter das Zitatrecht, welches in §51 UrhG geregelt ist. Danach dürfen einzelne Werke nach dem Erscheinen in ein selbstständiges wissenschaftliches Werk zur Erläuterung des Inhalts aufgenommen werden.
Dies gilt aber nicht für Abbildungen, die lediglich der Illustration dienen. Hierbei sollte jedoch beachtet werden, dass – wie bei wissenschaftlichen Textzitaten – alle Quellenangaben vollständig sind. Entscheidend ist aber auch die Bildgröße: S/W-Abbildungen bis zu einer halben Seitengröße werden i.d.R. als wissenschaftliche Zitate anerkannt. Abbildungen, die größer oder in Farbe (obwohl es im Text nicht dezidiert um die Verwendung von Farbe geht) gedruckt wurden, erfüllen oftmals nicht mehr den Rahmen des wissenschaftlichen Zitates, sondern fallen in den Bereich der illustrierenden Abbildungen. Tritt der Fall ein, dass Bilder nicht unter einer halben Seite gesetzt werden können, da ansonsten Bilddetails, die im Text besprochen werden, nicht sichtbar sind, sollte die Rechtesituation im Vorfeld geklärt werden.
Zudem sollten Sie unbedingt klären, ob noch Fotografen Rechte an den Bildern halten. Wenn nicht das Werk des jeweiligen Urhebers (Fotograf) Thema des Textes ist, sondern das auf der Fotografie abgebildete (z.B. Tänzer, Inszenierung), müssen die Fotografen bezüglich der Rechte angefragt werden. Sollten Rechte für einzelne Abbildungen eingeholt werden müssen, die nicht unter das Zitatrecht fallen, so ist dies Aufgabe der Autoren. Bildrechte können unter anderem über die VG BILD-KUNST eingeholt werden, die eine Vielzahl von Künstlern vertritt (www.bildkunst.de).
Des Weiteren frei verwendbar sind (vgl. §23 KunstUrhG):
- Bilder aus dem Bereich der Zeitgeschichte;
- Bilder, die nicht auf Bestellung angefertigt sind, sofern die Verbreitung einem höheren Interesse der Kunst dient. Print - E-Book - Open Access-Recht am eigenen Bild: Jede abgebildete Person hat grundsätzlich das Recht, selbst zu entscheiden, ob dieses Bild veröffentlicht werden darf.
Ausnahmen (vgl. §23 KunstUrhG):
- Bilder, auf denen die Personen nur als Beiwerk neben einer Landschaft oder sonstigen Örtlichkeiten erscheinen;
- Bilder von Versammlungen oder anderen öffentlichen Veranstaltungen, an denen die dargestellten Personen teilgenommen haben.
Tipp: Weitere Informationen finden Sie unter folgenden Links: www.bildkunst.de (speziell zu Ausnahmevorschriften beim Bildrecht: https://www.bildkunst.de/urheberrecht/kreativitaet-und-urheberrecht)
Quellenangaben werden bei Bildern in deren Bildunterschrift wie folgt vorgenommen: (Bildnachweis: © Rechteinhaber, ggf. Hinweis auf Zitationsrecht inkl. Verlinkung).
Geschlechtergerechte Sprache
Wir unterstützen geschlechtergerechte Sprache: Autor:innen dürfen gerne geschlechtergerecht schreiben – vorausgesetzt wird dies jedoch nicht. Hierzu ist es aufgrund der Inklusivität empfehlenswert, den Doppelpunkt zu nutzen, da dieser bei der Verwendung von Screenreadern als Pause „gesprochen“ wird.
Medienverzeichnis
Spielfilm:
›Titel. Untertitel‹ (Ort Jahr; Regie: Vorname Nachname).
Beispiel: ›Der 1. Ritter‹ (USA 1995; Regie: Jerry Zucker)
Serie:
›Titel. Untertitel‹ (Ort Jahr; Idee: Vorname Nachname).
Beispiel: ›Vikings‹ (Kanada/Irland seit 2013; Idee: Michael Hirst)
Serie – Einzelepisode:
Regie: Name: ›Titel Episode‹, in: ›Titel. Untertitel‹ (Ort Jahr; Idee/Drehbuch). Staffel Nr., Folge Nr.
Beispiel: Regie: Kari Skogland: ›Blutadler‹, in: ›Vikings‹ (Kanada & Irland 2014; Idee: Michael Hirst) Staffel 2, Folge 7.
YouTube:
Kanal: ›Titel‹ [Uploaddatum]. <URL> [TT.MM.JJJJ] (= Zeitpunkt des letzten Abrufs)
Bsp: CrashCourse: ›The Hero's Journey and the Monomyth: Crash Course World Mythology #25‹ [02.09.2017] <https://www.youtube.com/watch?v=XevCvCLdKCU> [TT.MM.JJJJ]
Musik:
Künstler/in: ›Songtitel‹, in: ›Albumtitel‹ (Label Jahr; Studio), Titelnummer.
Beispiel: Rotting Christ: ›Hallowed Be Thy Name‹, in: ›The Heretics‹ (Seasons of Mist 2019; Pentagram Studios), Titel Nr. 3.
Videospiel:
Entwicklerstudio, ›Titel. Untertitel‹ (Plattform, auf welcher das Spiel gespielt wurde) (Ort Jahr; Publisher).
Bespiel: Ubisoft Montreal, ›Assassin’s Creed: Valhalla‹ (Montreuil 2020; Ubisoft)
Gesellschaftsspiel:
Autor/in, ›Titel. Untertitel‹ (Verlag Jahr)
Beispiel: Uwe Rosenberg (Almanach: Gernot Köpke), ›Ein Fest für Odin‹ (Feuerlandspiele 2016).
Bibelzitate
Die Heilige Schrift wird primär nach der Vulgata zitiert, die einzelnen Bücher abgekürzt so angegeben:
Altes Testament
Gn = Genesis
Ex = Exodi
Lv = Levitici
Nm = Numerorum
Dt = Deuteronomii
Ios = Iosue
Idc = Iudicum
Rt = Ruth
1 Sm = Samuelis seu I Regum
2 Sm = Samuelis seu II Regum
3 Rg = Malachim seu III Regum
4 Rg = Malachim seu IV Regum
1 Par = Paralipomenon Ius
2 Par = Paralipomenon IIus
1 Esr = Ezrae Ius
2 Esr = Ezrae IIus (Nehemiae)
Tb = Tobiae
Idt = Iudith
Est = Hester
Iob = Iob
Ps = Psalmi
Ps (G) = Psalmi iuxta Septuaginta
Ps (H) = Psalmi iuxta Hebraeos
Prv = Proverbiorum
Ecl = Ecclesiastes
Ct = Canticum Canticorum
Sap = Sapientiae Salomonis
Sir = Iesu Filii Sirach, seu Ecclesiasticus
Is = Isaiae Prophetae
Ier = Hieremiae Prophetae
Lam = Threni, idest, Lamentationes
Bar = Baruch Prophetae
Ez = Hiezechielis Prophetae
Dn = Danihelis Prophetae
Os = Osee Prophetae
Ioel = Iohelis Prophetae
Am = Amos Prophetae
Abd = Abdias Prophetae
Ion = Ionae Prophetae
Mi = Micha Prophetae
Na = Naum Prophetae
Hab = Abacuc Prophetae
So = Sofoniae Prophetae
Agg = Aggei Prophetae
Za = Zacchariae Prophetae
Mal = Malachiae Prophetae
1 Mcc = Macchabeorum Ius
2 Mcc = Macchabeorum IIus
Neues Testament
Mt = Evangelii secundum Mattheum
Mc = Evangelii secundum Marcum
Lc = Evangelii secundum Lucam
Io = Evangelii secundum Iohannem
Act = Actuum Apostolorum
Rm = Epistula ad Romanos
1 Cor = Epistula ad Corinthios Iª
2 Cor = Epistula ad Corinthios IIª
Gal = Epistula ad Galatas
Eph = Epistula ad Ephesios
Phil = Epistula ad Philippenses
Col = Epistula ad Colossenses
1 Th = Epistula ad Thessalonicenses Iª
2 Th = Epistula ad Thessalonicenses IIª
1 Tim = Epistula ad Timotheum Iª
2 Tim = Epistula ad Timotheum IIª
Tit = Epistula ad Titum
Phlm = Epistula ad Philemonem
Hbr = Epistula ad Hebraeos
Iac = Epistula Iacobi
1 Pt = Epistula Petri Iª
2 Pt = Epistula Petri IIª
1 Io = Epistula Iohannis Iª
2 Io = Epistula Iohannis IIª
3 Io = Epistula Iohannis IIIª
Iud = Epistula Iudae
Apc = Apocalypsis Iohannis Apostoli
Schutz personenbezogener Daten
Namen und E-Mail-Adressen, die auf den Webseiten der Zeitschrift eingegeben werden, werden ausschließlich zu den angegebenen Zwecken verwendet und nicht an Dritte weitergegeben.